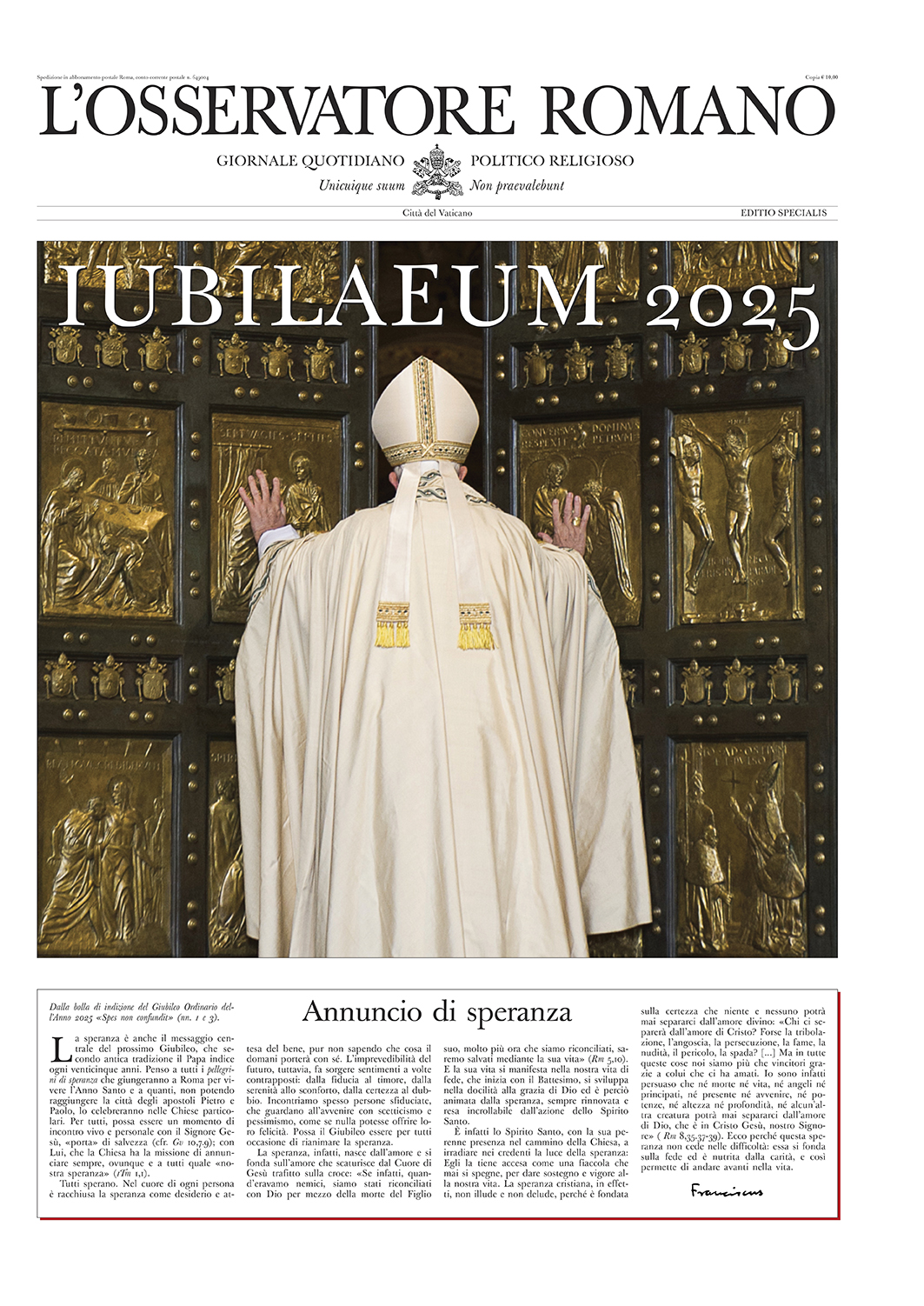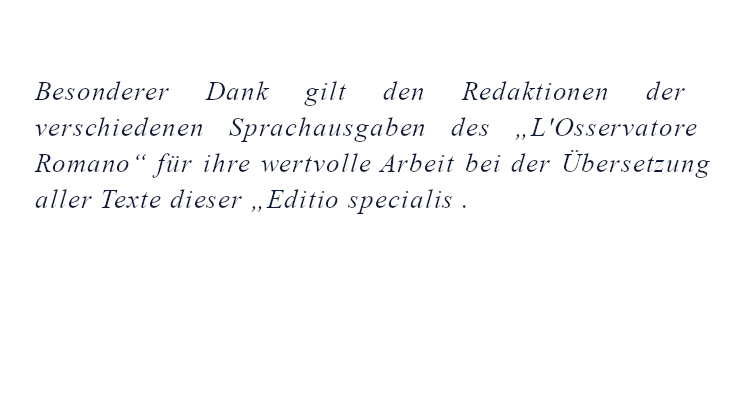Ablässe
Weder Formalismus noch Bürokratie, sondern ein spiritueller Weg, der das konkrete Leben jedes Menschen betrifft
»Der Ablass ist eine Jubiläumsgnade«, ein »Geschenk«, das »uns entdecken [lässt], wie grenzenlos Gottes Barmherzigkeit ist«. Das bedeutet, dass man, um ihn zu gewinnen, kein Formular ausfüllen oder eine Bescheinigung an einem speziellen Schalter vorlegen muss. Der Ablass ist keine bürokratische Praxis, die es zu erledigen gilt, sondern ein spiritueller Weg, der vom Herzen ausgeht und das konkrete Leben jedes Menschen betrifft, weil er nicht nur die Sünde auslöscht, sondern auch ihre Folgen aus dem menschlichen Herzen entfernt. Während des Heiligen Jahres wird er allen Gläubigen gewährt, die – erfüllt von aufrichtiger Reue und vom Geist der Nächstenliebe, geläutert und gestärkt durch die Sakramente der Buße und der Eucharistie – in den Anliegen des Papstes beten. Wie die Apostolische Pönitentiarie mitgeteilt hat, kann der Ablass ab dem 24. Dezember 2024 erlangt werden:
Bei Wallfahrten: in Rom in mindestens einer der vier großen päpstlichen Basiliken; im Heiligen Land in mindestens einer der drei Basiliken: des Heiligen Grabes in Jerusalem, der Geburtskirche in Bethlehem, der Verkündigungskirche in Nazareth. Außerdem in der Kathedralkirche oder in anderen vom Diözesanbischof bestimmten Kirchen und heiligen Stätten.
Bei frommen Besuchen heiliger Stätten: in Rom die Basiliken: Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo al Verano, San Sebastiano; das Heiligtum der göttlichen Liebe; die Kirchen Santo Spirito in Sassia, San Paolo alle Tre Fontane; die christlichen Katakomben; die Kirchen, die den Schutzpatroninnen Europas und den Kirchenlehrern gewidmet sind (Santa Maria sopra Minerva, Santa Brigida a Campo de’ Fiori, Santa Maria della Vittoria, Trinità dei Monti, Santa Cecilia a Trastevere, Sant’Agostino in Campo Marzio). An anderen Orten in der Welt: die Basiliken von Assisi, Loreto, Pompei und Padua, oder jede andere Kirche oder Wallfahrtsstätte, die vom Diözesan- oder Eparchialbischof bestimmt werden.
Durch Werke der Barmherzigkeit und der Buße: als »greifbares Zeichen der Hoffnung« wird der Ablass auch »an Werke der Barmherzigkeit und der Buße gebunden«, wie zum Beispiel die Besuche von Kranken, Gefangenen, alten einsamen Menschen, Behinderten. Oder durch die Neuentdeckung einer »bußfertigen Haltung am Freitag«, indem man auf überflüssigen Konsum verzichtet, zum Beispiel durch Fasten, durch eine Geldspende an die Armen und durch ehrenamtliche Tätigkeit. Oder durch die Unterstützung von Werken religiösen oder sozialen Charakters, insbesondere zugunsten der Verteidigung und des Schutzes des Lebens, der verlassenen Kinder, der Jugendlichen in Schwierigkeiten, der in Not geratenen oder einsamen alten Menschen, der Migranten.
Eine lange Geschichte Von der Zeit der Apostel bis in unsere Tage
Von der Zeit der Apostel bis heute lässt sich die Geschichte des Ablasses in vier große Abschnitte unterteilen.
Im ersten Abschnitt (vom apostolischen Zeitalter bis zum 8. Jahrhundert) entspricht der Ablass einer Herabsetzung der kanonischen Strafe, die erforderlich ist, um die Absolution für die Sünden zu erhalten, und wird durch die Bitten der Märtyrer gewährt.
Im zweiten Abschnitt (8.-14. Jahrhundert) erlaubte der Ablass zunächst die Umwandlung der sehr schweren kanonischen Strafe für gebeichtete Sünden in ein leichteres Werk. Im 11. Jahrhundert wurde der Ablass dann als Belohnung für ein Werk der Frömmigkeit gewährt, zum Beispiel für den Besuch einer neu geweihten Kirche oder das Spenden von Almosen an die Armen oder ein Kloster. In dieser historischen Phase kommt dem Ablass der Kreuzzüge besondere Bedeutung zu: Die Päpste gewähren den Kämpfern nämlich einen vollkommenen Erlass der Buße, die sie für die Sünden zu leisten hätten.
Seit dem 12. Jahrhundert nahm die Gewährung von Ablässen beträchtlich zu, bis zum Jahr 1300 und dem ersten Heiligen Jahr der Geschichte, das von Papst Bonifatius VIII. (Benedetto Caetani) ausgerufen wurde. Der damalige Papst erklärte in der Bulle Antiquorum habet fide relatio, dass der Ablass »nicht nur die volle und überreiche, sondern die vollkommene Vergebung aller Sünden« gewähren sollte. Damit wollte er die Außergewöhnlichkeit dieses Ablasses im Vergleich zu früheren Ablässen hervorheben, darunter auch der von Coelestin V., der 1294 in L’ Aquila mit der Bulle Inter sanctorum omnia solemnia einen vollkommenen Ablass für diejenigen gewährt hatte, die zwischen dem 28. und dem 30. August die Basilika Santa Maria di Collemaggio aufsuchten, nachdem sie »aufrichtig bereut und gebeichtet« hatten.
So gewährte Bonifaz VIII. im Vertrauen auf die »Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes« allen Römern einen Ablass, die die Basiliken der Apostel Petrus und Paulus in der Ewigen Stadt 30 Mal an 30 aufeinander folgenden Tagen besuchen (für Fremde war 15 Mal an 15 Tagen ausreichend) und »aufrichtig bereuen und beichten«. Gleichzeitig legte der Caetani-Papst die symbolische Zahl von 100 Jahren zwischen den Jubiläen fest. Dies wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach geändert, bis zur heutigen Kadenz von 25 Jahren, die 1470 von Paul II. im Hinblick auf das Heilige Jahr 1475 festgelegt wurde.
Im dritten Abschnitt, vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, ging der Brauch, Ablässe zu gewähren, mit der Möglichkeit einher, diese durch Geldspenden (»oblationes«) zu erwerben, um Werke des Apostolats zu unterstützen. Infolgedessen verbreitete sich unter den Gläubigen die irrige Überzeugung, dass es genüge, für einen Ablass zu »bezahlen«, um auch den Sündenerlass zu erhalten. Im Laufe der Zeit häuften sich die Missbräuche und der Ablass wurde immer mehr zu einer bloßen Finanztransaktion.
Martin Luther protestierte gegen diese Missbräuche, lehnte sich gegen den Heiligen Stuhl auf und löste 1517 die Reformation aus. Später, im 16. Jahrhundert, setzte das Konzil von Trient (1545-1563) den Missbräuchen ein Ende und verfügte, dass der Ablass den Gläubigen fromm, heilig und ganz gewährt werden sollte, »damit alle wirklich verstehen, dass diese himmlischen Schätze der Kirche nicht um des Gewinns willen, sondern aus Frömmigkeit verteilt werden«.
Im vierten Zeitabschnitt schließlich, vom 16. Jahrhundert bis heute, wurden die Ablässe geordnet und vereinfacht. 1967 schaffte Paul VI. die alte Zählweise des Erlasses nach Tagen, Monaten und Jahren ab. Heute ist es nützlich, sich daran zu erinnern, dass es keinen Automatismus gibt, der es erlaubt, einen Ablass zu erlangen, ohne sich aufrichtig von der Sünde loszusagen und die begangenen und gebeichteten Sünden wirklich zu bereuen. Denn Gottes Vergebung zu empfangen schließt eine echte Lebensänderung, eine Umkehr ein.
»ALLE, ALLE, ALLE!«
Barmherzigkeit und Vergebung in der Lehre von Papst Franziskus
Was hat eine Wäschereinigung mit dem Sakrament der Beichte zu tun? Und das Einwohnermeldeamt mit der Barmherzigkeit? Auf dem Papier absolut gar nichts. Wenn man aber genauer hinsieht, worauf uns Papst Franziskus in seinen Ansprachen öfter hinweist, sind die beiden Begriffe ganz und gar nicht voneinander getrennt.
Bei verschiedenen Anlässen hat der Papst die Metapher der Reinigung verwendet, um darauf hinzuweisen, dass der Beichtstuhl kein Ort sein darf, wo am die Sünden »trocken reinigt«, als wären sie ein Kleidungsstück, von dem man die Flecken entfernen will, sondern die Beichte muss ein Weg sein, ein »Gehen zum Vater, der über mich weint, weil er Vater ist«. Das heißt ein Weg, um sich von Gott geliebt zu fühlen.
Außerdem sagt der Papst: »Wir gehen nicht zur Beichte, um uns zu erniedrigen, sondern um uns aufrichten zu lassen. Das haben wir alle nötig. Wir haben es nötig wie kleine Kinder, die jedes Mal, wenn sie hinfallen, von ihrem Papa hochgehoben werden müssen. Auch wir fallen oft. Und die Hand des Vaters ist bereit, uns wieder auf die Füße zu stellen, sodass wir weitergehen können. Diese sichere und zuverlässige Hand ist die Beichte. Sie ist das Sakrament, das uns aufrichtet, das uns nicht weinend auf dem harten Boden liegen lässt, wenn wir stürzen. Sie ist das Sakrament der Auferstehung, sie ist reine Barmherzigkeit.«
Das geschieht, weil »der Name Gottes Barmherzigkeit ist« – hier der Hinweis auf das Einwohnermeldeamt —, ja die Barmherzigkeit ist »der Ausweis Gottes«. Sie ist »unendlich größer als unsere Sünde«, denn »Gott ist ein fürsorglicher, aufmerksamer Vater, der bereit ist, jeden Menschen aufzunehmen, der einen Schritt auf ihn zu macht oder den Wunsch hat, einen Schritt auf ihn hin zu machen«, und »keine menschliche Sünde, wie schwer sie auch sein mag, kann die Barmherzigkeit außer Kraft setzen und sie begrenzen«. Denn wie der Vater des verlorenen Sohnes erwartet er uns immer, kommt uns entgegen und umarmt uns, noch bevor wir unsere Sünden eingestehen.
Papst Franziskus unterstreicht also, dass man nicht berechnend sein darf, wenn man vergibt, sondern »dass es gut ist, alles und immer zu vergeben«, so wie Gott vergibt, das heißt »über jedes Maß hinaus«, indem man »aus Liebe und Unentgeltlichkeit« handelt. Sicher, wir wissen alle, dass es oft schwer ist, zu vergeben. Auch der Papst weiß dies und genau deshalb erinnert er uns daran, dass »Vergebung das Instrument ist, das in unsere schwachen Hände gelegt wurde, um den Frieden des Herzens zu finden … um glücklich zu sein«. Denn »außerhalb der Vergebung gibt es keinen Frieden. Die Vergebung ist der Sauerstoff, der die vom Hass verpestete Luft reinigt; die Vergebung ist das Gegenmittel, das die Gifte des Grolls abwehrt; sie ist der Weg, den Zorn zu entschärfen und so viele Krankheiten des Herzens zu heilen, die die Gesellschaft verseuchen.«
Vergebung und Barmherzigkeit sind grundlegende Themen des Pontifikats von Franziskus: nicht ohne Grund lautet sein Wahlspruch – zuerst als Bischof und dann als Papst – »Miserando atque eligendo«. Man könnte das lateinische »miserando« auch mit dem neuerfundenen italienischen Gerundium »misericordiando« übersetzen, das heißt kontinuierlich Barmherzigkeit praktizierend, nicht auf einen Augenblick begrenzt, sondern immer wieder neu.
In der Tat ist Barmherzigkeit nicht statisch, sondern eine Bewegung, sie ist ein »Hin und Her«, unterstreicht der Papst. Sie »erneuert und erlöst, da sie die Begegnung zweier Herzen ist: des Herzens Gottes, das dem Herzen des Menschen entgegenkommt. … Hier nimmt man wahr, wirklich ›neue Schöpfung‹ zu sein: Ich bin geliebt, daher lebe ich; mir wird vergeben, daher werde ich zu neuem Leben geboren; mir wurde Barmherzigkeit zuteil, daher werde ich zum Werkzeug der Barmherzigkeit.«
Die Zentralität dieses Themas wir auch durch das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit bestätigt, das der Papst 2016 ausgerufen hat: ein außerordentliches Heiliges Jahr, »um im Alltag die Barmherzigkeit zu leben, die der Vater uns von Anbeginn entgegenbringt. … Er wird nicht müde, die Tür seines Herzens offen zu halten und zu wiederholen, dass er uns liebt und sein Leben mit uns teilen will.«
Mögen nun, da wir ein neues Heiliges Jahr erleben, diese Worte uns auf unserem Pilgerweg begleiten, in dem Bewusstsein, dass – wie es der Papst oft und oft wiederholt hat – »In der Kirche gibt es Platz für alle. Für alle. In der Kirche ist niemand überflüssig. Keiner ist überflüssig. Es ist Platz für alle. So wie wir sind. Alle. … ›Vater, aber ich bin ein Unglücklicher, ich bin eine Unglückliche, ist da Platz für mich?‹ Da ist Platz für alle!« Denn »Gott liebt uns, wie wir sind, nicht wie wir gerne wären oder wie die Gesellschaft uns gerne hätte. So wie wir sind! Er ruft uns mit den Mängeln, die wir haben, mit den Begrenzungen, die wir haben, und mit den Wünschen, die wir haben, um im Leben voranzukommen. Gott ruft uns so. Habt Vertrauen, denn Gott ist ein Vater und ein Vater, der uns gern hat und ein Vater, der uns liebt.«
Das ist die Logik des Herrn, der sich nicht damit aufhält, »die Situation am grünen Tisch zu studieren«, sondern allen entgegengeht, ohne Unterschied. Denn wir sind alle, alle, alle Kinder eines Gottes, der Liebe ist.