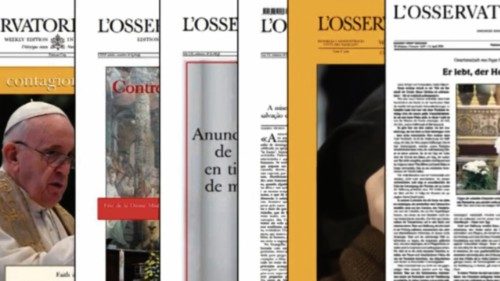
Die deutsche Ausgabe des »Osservatore Romano« gibt es seit 1971, und sie erscheint wöchentlich. Doch sie ist Teil eines größeren und älteren Projekts: Die Mutterausgabe in italienischer Sprache erschien am 21. August zum 50.000. Mal. Aus diesem Anlass blickt Direktor Andrea Monda auf den Auftrag und das Selbstverständnis der Zeitung. Zwar begleitet die italienische Ausgabe als Tageszeitung das politische Geschehen stärker, aber ob Tages-, Wochen- oder Monatsausgabe in verschiedenen Sprachen: »L’Osservatore Romano« als Zeitung des Heiligen Stuhls hat eine gemeinsame Stimme. Aus Rom für die Welt. Der »Osservatore Romano« erscheint heute in mehreren Sprach- und Sonderausgaben: als italienische Tageszeitung, in monatlichen Ausgaben auf Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Malayalam – und einzig auf Deutsch als Wochenausgabe. Ergänzt wird das Profil der gemeinsamen Stimme durch die Monatszeitschrift »Donne Chiesa Mondo«, die Frauen in den Mittelpunkt stellt und den »L’Osservatore di Strada«, eine kostenlose Monatsausgabe, die mit und für Arme und Ausgegrenzte gestaltet wird.
Von Andrea Monda
Man darf sich niemals zu sehr allein auf Zahlen verlassen, auf jene »neun Ziffern und die füchtige Null«, wie Borges sie nennt, denen man nicht zu viel Gewicht beimessen sollte. Der Gläubige weiß, dass das Leben ein fortdauernder Dialog mit Gott ist, und dass »tausend Jahre in deinen Augen wie der Tag sind, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht«. Und gerade deshalb bittet er im selben Psalm 90 den Herrn um eine Kunst, die er offensichtlich noch nicht beherrscht: »Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann gewinnen wir ein weises Herz.« Doch während wir noch darauf warten, dass das Herz weise wird, helfen uns die Zahlen, unsere Schritte zu zählen. Einen nach dem anderen. Und 50.000 ist eine Zahl, die nicht unbemerkt bleiben kann (vor allem nicht für eine Zeitung, die sich das Beobachten zur Daseinsberechtigung gemacht hat).
50.000. Diese Zeitung hier, die der Leser in Händen hält oder in der digitalen Ausgabe liest, ist die Nummer fünfzigtausend des Osservatore Romano, wie oben links unter dem Zeitungskopf angegeben ist.
Die Nummer eins erschien vor 164 Jahren, am 1. Juli 1861. Die geschichtliche Bedeutung ist greifbar. Die Zeitung entstand wenige Monate nach der Ausrufung des Königreiches Italien am 17. März, mit dem Untertitel »Gior-nale politico-morale« (»Politisch-moralische Zeitung«), der später durch den heutigen ersetzt wurde: »Giornale politico religioso« (»politisch-religiöse Tageszeitung«). Sie umfasste vier Seiten und kostete 5 Baiocchi (etwa 27 Centesimi der damaligen Lire). Eine politische und religiöse Zeitung also, die sowohl von der Stadt Gottes als auch von der Stadt des Menschen erzählen wollte. Dieser stereoskopische Blick, der versucht, eine Sichtweise zu bezeugen, die über das Menschliche hinausgeht, wird von dem weiteren doppelten »Untertitel« bekräftigt, der sehr bald erscheint – ab der ersten Ausgabe im Jahr 1862 – und in den beiden lateinischen Zitaten besteht, die die Zeitung noch heute begleiten: Unicuique suum (»Jedem das Seine«, von Ulpian) und Non praevalebunt ([die Pforten der Unterwelt] »werden sie nicht überwältigen«, Mt 16,18) (Anm. d. Red.: Diese Untertitel gelten auch für die deutschsprachige Wochenausgabe).
Der Osservatore Romano, der ab dem
31. März 1862 tatsächliche eine Tageszeitung wurde, ist eine neugierige Zeitung, die alles Menschliche im Licht des Glaubens kennen und verstehen will. Um es mit einem anderen Klassiker, Terenz, zu sagen: Homo sum, humani nihil a me alienum potu (»Ich bin Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd«).
Der Osservatore ist eine »Zeitung der Ideen«, wie Giovanni Battista Montini aus Anlass des hundertjährigen Bestehens am
1. Juli 1961 schrieb. »Er ist nicht, wie so viele andere, ein reines Informationsorgan. Er will ein Werkzeug zur Bildung sein, und ich glaube, vor allem das«, schrieb der damalige Erzbischof von Mailand. »Er will nicht nur Nachrichten übermitteln; er will Gedanken kreieren. Es genügt ihm nicht, die Fakten so zu berichten, wie sie sich ereignen: er will sie kommentieren, um darauf hinzuweisen, wie sie hätten geschehen sollen oder nicht hätten geschehen sollen. Er geht nicht nur mit seinen Lesern ins Gespräch, sondern mit der Welt: kommentiert, diskutiert, polemisiert. Und wenn dieser Aspekt beim Leser Interesse erweckt, ruft dies im Schreibenden enorme Anstrengung hervor. Es genügt dem Redakteur nicht, Telefone, Fernschreiber, Mitteilungen, Agenturen, Schere und Kleber zu benutzen; er muss seine Urteilskraft einsetzen, seine Bewertung; er muss aus seiner Erfahrung und noch mehr aus seiner Seele ein Wort hervorsuchen; ein Wort, das sein eigenes ist, lebendig, neu, genial. Und vor allem wahr. Vor allem gut. Hier ist der Journalist Übersetzer, Lehrer, Leitfigur, und manchmal Poet und Prophet. Eine schwierige Kunst. Erhaben, ja, aber schwierig.«
Die Worte des späteren Paul VI. sind scharf, präzise und erschöpfend und, skizzieren, heute vielleicht mehr als damals, auf lebendige Art und Weise die poetische und prophetische Berufung der Zeitung des Heiligen Stuhls. Und sie unterstreichen die Schwierigkeit der Herausforderung, die in dieser Mission liegt. Auch deshalb bleibt uns nur ein Wort als Kommentar zu diesem Meilenstein auf unserem Weg – 164 Jahre und 50.000 Ausgaben: Danke.
Danke den dreizehn Päpsten, von Pius IX. bis Leo XIV., die die Mission der Zeitung unterstützt und vorangetrieben haben; den elf Direktoren, von den beiden Gründern Nicola Zanchini und Giuseppe Bastia bis zu Gian Maria Vian, die die Fackel der Zeitung Hand in Hand, durch die stürmischen Zeiten von drei Jahrhunderten getragen haben, ohne sie erlöschen zu lassen; den vielen Redakteuren und Mitarbeitern, die mit Vertrauen und Mühen jeden Tag an der Produktion jeder dieser 50.000 Ausgaben gearbeitet haben und den unzähligen Lesern, die dieses großartige Abenteuer mit Zuneigung und Wertschätzung begleitet haben.
Ihnen allen und vor allem Ihnen, liebe Leser: Herzlichen Dank!












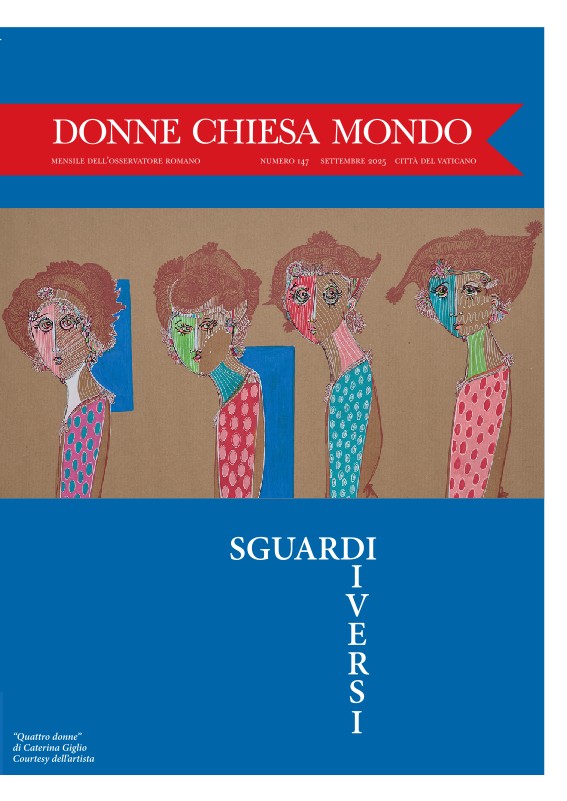
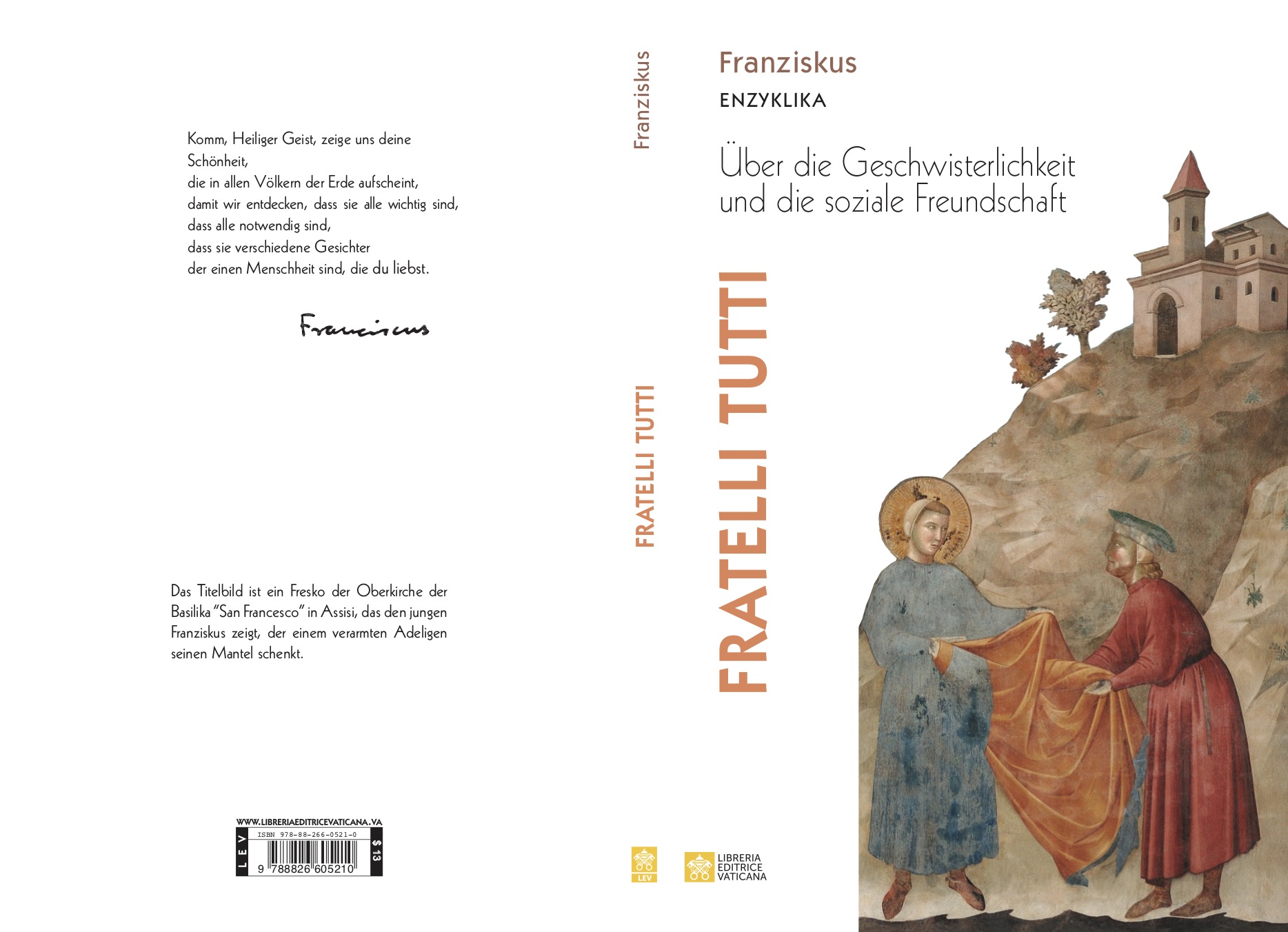 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
