
In seiner dritten Meditation zur Fastenzeit 2025 stellte Pater Roberto Pasolini am Freitag, 4. April, in der Vatikanischen Audienzhalle die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi für das persönliche und gemeinschaftliche Leben in den Mittelpunkt. Er betonte, dass die Auferstehung nicht als Akt der Rache oder Machtdemonstration zu verstehen sei, sondern als Aufruf zu Neubeginn und Versöhnung.
Im Jubiläumsjahr sind wir aufgerufen, durch die Heilige Pforte zu gehen. Dabei handelt sich auch um einen symbolischen Schritt, mit dem wir unserem Wunsch Ausdruck verleihen, die Sünde hinter uns zu lassen, um in das Leben Christi einzutreten, denn er ist die Tür zur Hoffnung und der Weg zum Heil. Diese Fastenmeditationen haben uns daran erinnert: Wenn wir eng mit Ihm vereint bleiben wollen, müssen wir in den Wassern unserer Taufe schwimmen lernen, indem wir unsere Bewegungen mit dem Rhythmus des Evangeliums in Einklang bringen. In dem Maße, in dem wir den inneren Eingebungen des Heiligen Geistes folgen, entdecken wir unsere Fähigkeit, einen Weg zu gehen, der uns dazu führt, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen, in aller Freiheit und Gottes Liebe entsprechend.
Sicherlich ist die Auferstehung der Moment des Lebens Christi, der uns auf unserem Weg der Jüngerschaft am meisten inspiriert. Aus der Betrachtung dieser Etappe des ebenso entscheidenden wie geheimnisvollen Christusereignisses können wir das Licht schöpfen, das notwendig ist, um unseren Schritten die richtige Richtung zu geben, ohne falsche oder zu ideale Erwartungen zu hegen in Bezug auf das, was wir nach Gottes Willen zu leben berufen sind.
Den Blick auf die Auferstehung zu richten, bedeutet, sich nicht von der Angst vor Leid und Tod überwältigen zu lassen, sondern das Ziel vor Augen zu haben, zu dem uns die Liebe Christi führt. Um durch Christus, die Pforte zur Fülle des Lebens, zu gehen, ist ein kostbarer Verzicht notwendig: Wir müssen die Meinung aufgeben, es sei unmöglich, nach Versagen und Niederlage mit Vertrauen im Herzen wieder aufzustehen, bereit, neu anzufangen und sich den anderen wieder zu öffnen, insbesondere dem gegenüber, der uns verletzt hat, der aber nicht das zwischen uns bestehende Band zu zerreißen vermochte.
1. Sich nicht ärgern
Die größte Überraschung in den Evangelien ist nicht so sehr die Tatsache, dass ein Mann – der Sohn Gottes – von den Toten auferstanden ist, sondern die Art und Weise, wie er dies tun wollte. Denn so hat er uns ein wunderbares Zeugnis dafür hinterlassen, wie die Liebe sich nach einer großen Niederlage wieder aufrichten kann, um ihren unaufhaltbaren Weg fortzusetzen.
Es ist gut, wenn wir hierbei von einer allgemein verbreiteten Erfahrung ausgehen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, und uns wieder zu fassen, uns wieder aufzurichten, nachdem wir im Bereich unserer Affektivität ein schweres Trauma erlitten haben, dann denken wir meist zuerst daran, wie wir uns rächen können, zum Beispiel indem wir es demjenigen, den wir für das uns zugefügte Leid verantwortlich machen, heimzahlen. Nachdem Jesus das Totenreich verlassen hat, spürt er nicht das Bedürfnis, sich aufgrund des Geschehenen aufzuregen, über nichts und niemand, und er muss auch nicht seine Überlegenheit denjenigen gegenüber de-monstrieren, die bei seinem Tod Protagonisten oder Mittäter waren. Das Einzige, was Jesus – nunmehr Herr über Leben und Tod – zu tun gedenkt, ist, sich seinen Freunden zu offenbaren, und das sehr sparsam und mit freudiger Schlichtheit.
In jedem der vier Evangelien finden wir eine Bestätigung für diese Art und Weise, wie Jesus vom Tod aufersteht, nämlich frei von Rachegedanken oder der Notwendigkeit der Vergeltung. Am deutlichsten erkennbar ist dies vielleicht im Text von Markus, vor allem, wenn wir die Lektüre beim ursprünglichen Schluss des Evangeliums beenden, wo die Frauen voller Angst das Grab verlassen und niemandem von der Verkündigung der Auferstehung durch den jungen Boten berichten (vgl. Mk 16,8). Das älteste Evangelium endet damit, ohne dass von einer Erscheinung des Auferstandenen berichtet wird. Für die ersten Generationen von Chris-ten war das Zeichen des leeren Grabes ausreichend, sowohl um an die Auferstehung zu glauben als auch um anderen die Freude des neuen Lebens in Christus zu verkünden. Die zwölf Verse mit den Erscheinungen des Auferstandenen und seiner Himmelfahrt vor den Augen der Apostel (Mk 16,9-20), die dem Markustext später hinzugefügt wurden, enthalten Informationen, die von der Kirche als wahr und inspiriert angesehen werden, die aber ursprünglich nicht für notwendig gehalten wurden, um an das Geheimnis der Auferstehung zu glauben.
Das Matthäusevangelium unterstreicht die sachliche Nüchternheit des Osterereignisses anders. Als die Frauen sich vom leeren Grab entfernen, erscheint ihnen Jesus, um die Verkündigung der Auferstehung, die sie vom Engel empfangen haben, zu bestätigen. Unmittelbar danach geht es dem Evangelisten jedoch darum, zu erklären, warum die Auferstehung Christi ein von Anfang an stark bezweifeltes, historisches Ereignis ist.
»Noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Diese fass-ten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. Und dieses Gerücht verbreitete sich bei Juden bis heute« (Mt 28,11-15).
Angesichts dieser Schwäche, mit der sich die Auferstehung Christi vollzog, fragen wir uns unwillkürlich: Warum hat Jesus, der Herr, als er von den Toten auferstand, seinen Sieg nicht mit größerer Macht und Klarheit gezeigt? Warum hat er eine Weise der Offenbarung gewählt, die so zurückhaltend ist, dass sie nicht nur Missverständnisse, sondern auch eine gewisse Skepsis gegenüber einem Ereignis hervorrufen kann, das unser Fassungsvermögen so sehr übersteigt und gleichzeitig so notwendig für die Erlösung der Welt ist? Wäre es nicht besser gewesen, sich zu rächen und die Wahrheit und Macht Gottes zu zeigen, um dem Ereignis der Auferstehung größere Überzeugungskraft zu verleihen?
Die einzige Antwort auf diese Fragen findet man, wenn man die Auferstehung als Erfahrung der Liebe und nicht als Machtdemonstration von Seiten Gottes deutet. Die Logik der Liebe lässt uns verstehen, warum Jesus es überhaupt nicht für notwendig hält, sich den Menschen aufzuzwingen, sondern nur den großen Wunsch spürt, sich weiterhin als Möglichkeit anzubieten. So wird der heilige Paulus nach seiner Begegnung mit dem Auferstandenen schreiben: Die Liebe »sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. […] Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand« (1 Kor 13,5-7). Diese Intensität der Liebe, die in der Lage ist, alles hinter sich zu lassen, bedeutet nicht, dass Gott unempfindlich oder gefühllos für das Leid wäre. Wer wirklich liebt, hat nicht das Bedürfnis, die erlittenen Ungerechtigkeiten zu zählen, weil die Freude über das Erlebte jeden Groll überwindet, auch wenn die Dinge nicht so gelaufen sind, wie man es sich vorgestellt hatte.
Damit auch wir selbst uns in einer dem Evangelium entsprechenden Weise wieder aufrichten können – nachdem wir die unvermeidlichen Traumata erlitten haben, denen wir in unseren Beziehungen ausgesetzt sind –, sollten wir vielleicht prüfen, wie viel Freiheit wir in unseren Worten und Gesten den anderen gegenüber haben. Wenn wir bemerken, dass wir oft enttäuscht sind oder dass wir uns zu sehr aufregen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt hatten, dann sollten wir uns vielleicht fragen, mit wie viel Uneigennützigkeit wir unsere Beziehungen leben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir die Zeit damit verbringen, uns zu beklagen, die Dinge klarstellen zu wollen und eine Entschädigung für die erlittenen Enttäuschungen zu suchen, wodurch wir für uns selbst und für die anderen zu einer Last werden. Aber so vergessen wir, dass das wahre Glück, das uns wirklich liebenswürdig macht, nicht von den Umständen oder von den anderen abhängt, sondern vielmehr vom Frieden, mit dem wir das annehmen, was das Leben uns bietet. Außerdem: Wenn jemand nicht glücklich ist über das, was ihm das Leben zu sein gewährt, was kann es ihm dann nützen, nach einem Tod ins Leben zurückzukehren?
2. Auf-Stand
Die Berichte von den Erscheinungen Jesu zeigen, dass die Auferstehung in keiner Weise als Wiederbelebung eines Leichnams gedeutet werden kann, sondern als Aufwachen, ja »Aufstand« eines Lebenden verstanden werden muss. Das neue und ewige Leben, das der Vater dem Sohn nach seiner Grablegung geschenkt hat, ist keine andere Existenz, sondern die Folge jenes Lebens, das so sehr vom Guten erfüllt war und überströmte, dass der Tod es nicht auszulöschen vermochte.
»Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen« (Joh 20,19-20).
Nachdem Jesus in die Unterwelt hinabgestiegen ist, um die Verstorbenen bei der Hand zu nehmen, betritt er den verschlossenen Raum derer, die noch immer Gefangene der Angst vor dem Sterben und der Trauer über das Scheitern sind, um ihnen das Geschenk eines beispiellosen Friedens zu machen. Schon der – so einfache und gewöhnliche – Gruß an die Jünger stellt eine große Überraschung dar, aber die Geste, mit der Jesus sich zu zeigen beschließt, verstößt darüber hinaus gegen alle Regeln der Etikette: Warum diese Wunden zeigen, anstatt sie zu verbergen, jene Wunden, die die schmerzhafte Erinnerung an das Leiden wachrufen könnten, als die Menschlichkeit der Zwölf sich von ihrer schlechtesten Seite zeigte: Verrat, Flucht, Verleugnung? Warum es so unverhohlen und dreist tun? Aber vor allem: Warum freuen sich die Jünger, anstatt traurig zu sein?
Wie wir bereits gesehen haben, zeigt Jesus unverzüglich die Zeichen des Leidens, weil er vollkommen versöhnt ist mit dem, was er erlebt und erlitten hat. Aber sein Wunsch ist es, dass auch seine Freunde bald Frieden finden und nicht in einem nutzlosen Schuldgefühl eingeschlossen bleiben mögen. Daher stellt er sich vor sie hin, nackt und bloß, unbewaffnet, sichtbar und erkennbar, ohne Erpressung und ohne Forderungen. Jesus wollte seine Freunde nicht verlieren, und jetzt möchte er ihnen dieselbe Chance geben, dass sie ihn nicht verlieren. Nur wenn wir im Gesicht desjenigen, den wir beleidigt oder verraten haben, das Zeichen echten Friedens sehen, können wir hoffen, dass wir eine neue, vielleicht stabilere Gemeinschaft mit ihm und mit uns selbst gefunden haben.
Jesus steht vor seinen Jüngern mit der Freude desjenigen, der einen guten Grund hatte, zu leiden und zu sterben: und dieser Grund, das sind genau sie. Die taktvoll und wohlwollend gezeigten Wunden werden zum Zeichen für ein echtes Angebot zur Vergebung. Im Allgemeinen schämen wir selbst uns weit mehr, wenn wir uns mit jemandem versöhnen müssen, nicht weil wir besser wären, sondern weil wir weniger Frieden haben. Zu dem, der uns enttäuscht und betrübt hat, sagen wir: »Mach dir keine Sorgen. Das ist alles Vergangenheit.« Aber in Wirklichkeit verbergen wir dabei sorgsam die noch offenen Wunden, allerdings eher um großherzig zu erscheinen als aus einem wahren Impuls des Mitleids und der Vergebung heraus. Jesus dagegen zeigt den Jüngern ohne Vorbehalt seinen verwundeten Leib, aber weder um seine Macht zur Schau zu stellen, noch um Schuldgefühle zu wecken. Die Jünger können endlich verstehen, dass Auferstehung bedeutet, sich über das Lächeln eines Menschen zu freuen, der glücklich ist, auch wenn du ihn enttäuscht hast, weil ihm das die Gelegenheit gegeben hat, dir dennoch seine Liebe anzubieten. Eine derartige Liebe kann man weder lehren noch erklären, sondern nur weitergeben.
»Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten« (Joh 20,21-23).
Die Apostel werden keineswegs von ihren Aufgaben entbunden, sondern vielmehr darin bestärkt durch einen Auftrag, der nicht so sehr als Machtausübung zu verstehen ist, sondern vielmehr als Übernahme einer wunderbaren Verantwortung. Als würde Jesus zu ihnen sagen: »Wer, wenn nicht ihr, könnte in der Welt ein Werkzeug der Versöhnung sein, nach all dem, was ihr erlebt und erlitten habt?« Die Apostelgeschichte und die gesamte Kirchengeschichte bestehen aus einer Abfolge von Männern und Frauen, die mit Nachdruck die Vergebung der Sünden verkünden, nicht weil sie sich für die einzigen Hüter der Liebe halten würden, sondern weil sie unmöglich schweigen können über das, was sie gesehen, gehört und erlebt haben (vgl. Apg 4,20).
Jesus zeigt sich als der Auferstandene, nicht um nur von Schuldbewusstsein zu befreien oder vergängliche Emotionen zu wecken. Indem der auferstandene Herr die Apostel anhaucht und ihnen den Heiligen Geist vermittelt, der ihn bei seiner Sendung im Auftrag des Vaters geführt hat, gibt er ihnen sein eigenes Leben und seine eigene brennende Liebe. Auferstehen bedeutet auch dies: Dem das Leben wiedergeben, der es verloren hat, oder demjenigen neues Vertrauen einflößen, der nicht mehr die Kraft hat, zu glauben. Wenn Leben bedeutet, fruchtbar und schöpferisch zu sein, warum sollten wir dann eigentlich glücklich sein, ins Leben zurückzukehren, wenn da nicht jemand wäre, dem wir (das) Leben schenken können?
Dennoch ist es nicht leicht, sich neu beleben zu lassen. Davon weiß Thomas ein Lied zu singen, der nicht dabei war, als Jesus den Jüngern erschien und ihnen den Heiligen Geist und den Frieden schenkte. Sein Verhalten, etwas zu vorschnell als »Unglaube« etikettiert, ist in Wirklichkeit etwas Mühsames, das man berücksichtigen muss, wenn man eintreten will in die Freude über die Auferstehung Christi.
Thomas lässt sich nicht so leicht von der Nachricht der Auferstehung begeistern. Nicht weil er es weniger brauchen würde als die anderen Jünger, sondern weil er – bevor er wieder aufatmen und lächeln kann – sicher sein will, dass Gott sich nicht darauf beschränkt, das Böse und das Leid zu vergessen, sondern sich auch auf neue Weise daran zu erinnern weiß. Für Thomas reicht ein Schulterklopfen oder »Schwamm drüber« nicht aus. Er glaubt nicht an die Auferstehung, solange er nicht persönlich seine Nase in diese Angelegenheit hineinsteckt, weil er die Wunden nicht nur sehen, sondern sie auch berühren will.
»Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht« (Joh 20,25).
Thomas verkörpert jenen Teil von uns, der sich nicht damit zufriedengibt, sich die Tränen abzuwischen und ein künstliches Lächeln aufzusetzen, sondern der eine echte Freude will, eine vollkommene und endgültige Freude, um wieder wirklich leben zu können. Er sucht keine vergänglichen Tröstungen, sondern eine wahre Antwort – die standhalten kann angesichts des Ärgernisses von Leid und Verlust – auf jenes schmerzliche Geheimnis, demnach auch die schönsten Dinge unerklärlicherweise vorbeigehen können. Bevor er sich von der Auferstehung berühren lässt, möchte er daher die Wunden der Liebe mit Händen greifen. Er gibt sich nicht zufrieden mit beruhigenden Worten oder vagen Hoffnungen: Er verlangt einen konkreten Beweis, ein greifbares Zeichen, dass der Schmerz nicht ausgelöscht, sondern überstanden und verwandelt wurde. Nur so kann er glauben, dass es wirklich ein Happy End gibt, bei dem die Wahrheit der Tatsachen nicht geleugnet, sondern erlöst wird.
»Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott!« (Joh 20,26-28).
Acht Tage darauf, an dem Tag, an dem sich die Gemeinschaft im Gedenken an Jesus versammelt, erscheint der Auferstandene und bringt das Geschenk des Friedens. Ohne dass er darum gebeten werden müsste, wendet er sich sofort an Thomas. Er tadelt ihn nicht, sondern schenkt ihm all das, was er braucht. Thomas hat den Glauben nicht aus Sturheit abgelehnt, sondern weil er den Wunsch hatte, eine authentische Ostererfahrung zu machen, indem er das Geschehene mit seiner eigenen Sensibilität als wahr anerkennt. Statt passiv den Bericht der anderen zu akzeptieren, hat er beschlossen, sich die Zeit zu nehmen, die notwendig ist, um sich von der Liebe Christi erreichen zu lassen und eine persönliche, tiefe Erfahrung von ihr zu machen. Es wird nicht gesagt, dass Thomas wirklich Hand und Finger ausgestreckt hat, aber bereits die Möglichkeit, dies zu tun, hat ihn einen enormen Fortschritt im Glauben machen lassen. Das kleine, zweimal wiederholte Possessivpronomen – »Mein Herr und mein Gott!« – lässt uns entdecken, dass zwar alle den Auferstandenen gesehen haben, aber es nur Thomas gelungen ist, ihn sich zu eigen zu machen.
»Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben« (Joh 20,29).
Der Schritt zum Glauben, den Thomas gemacht hat, ist viel größer als das, was die Realität ihm gezeigt hat. Während er nur die Evidenz eines vom Leid verwundeten Leibes vor Augen hat, kann er daran glauben, dass sein Schöpfer und Erlöser vor ihm steht. Die Worte Jesu verkünden Hoffnung: Sie offenbaren, dass dieses Wachsen im Glauben eine Seligkeit ist, die im Lauf der Geschichte vielen offenstehen wird. Die Freude über die Auferstehung gehört dem, der den Mut hat, nicht bei einem Glauben stehenzubleiben, der aus Parolen und vorgefertigten Ideen besteht. Die Seligkeit des neuen Lebens gehört denen, die beschließen, einen authentischen Weg zu gehen, die sich für eine lebendige und begeisternde Begegnung mit dem Auferstandenen entscheiden. Eine Begegnung, die immer in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern stattfindet, aber in vollkommener Achtung der einzigartigen Sensibilität jedes einzelnen.
3. Neu entfachen
Sehen wir uns die Auferstehungsberichte in den Evangelien an, werden wir mit der besonderen Tatsache konfrontiert, dass der Auferstandene es nicht nötig hat, auffällige und außergewöhnliche Gesten zu vollziehen, um das Geschenk seiner neuen Existenz offenbaren zu können. Das Licht seiner Auferstehung ist weit weniger blendend als das der Verklärung. Keiner seiner Freunde scheint ihn zu erkennen: Maria von Magdala verwechselt ihn mit einem Gärtner, die Apostel halten ihn für einen aufdringlichen Fischer, die Emmausjünger für den ahnungslosesten Einwohner Jerusalems. Warum all dieses Widerstreben, die Wirklichkeit mit einem kleinen Spezialeffekt anzureichern, durch den die Wahrheit der Auferstehung leichter hervorgetreten wäre? Warum offenbart sich der Herr, nachdem er in der Unterwelt die Befreiung verkündet hat, der Welt mit einer fast entwaffnenden Diskretheit?
Wir hätten eine feierliche Rede erwartet, die die Geheimnisse der Geschichte und des Universums enthüllt, oder eine Demonstration jener Macht, die Wirklichkeit verändern und deren Grenzen überwinden kann. Stattdessen zeigt sich der Auferstandene nur selten und spricht mit Augenmaß. Er will sich diskret nähern und grüßt, ohne Furcht einzuflößen. Er wird zum Tischgenossen und teilt mit heiterer Einfachheit die Freude über ein brüderliches Mahl.
»Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen« (Lk 24,36-43).
Soll das heißen, dass Christus nur auferstanden wäre, um zu den Jüngern sagen zu können: »Wollen wir gemeinsam etwas essen?« Ja, denn dieses nun erneut mögliche, einfache Beisammensein offenbart zwei wichtige Aspekte. Der erste ist sehr einfach: Jesus ist kein Gespenst oder Geist, sondern ein vom Tod auferstandener Leib. Das ist auch eine Offenbarung der Bestimmung, die unser Menschsein erwartet, nämlich die Auferstehung des Fleisches und nicht nur das Heil der Seele. Der zweite Aspekt ist schwieriger zu beschreiben, aber wunderbar zu genießen. Jesus nimmt sich Zeit, um etwas absolut Gewöhnliches zu tun, und so zeigt er den Jüngern, dass nach seiner Auferstehung von den Toten jeder Moment des Lebens eine Offenbarung und Vorwegnahme des Himmelreiches werden kann.
Essen, arbeiten, spazieren gehen, putzen, schreiben, reparieren, warten, sich beeilen: alles, absolut alles, was die Wirklichkeit uns erleben lässt, kann Ausdruck einer neuen Art und Weise sein, die Dinge zu erleben, nämlich als Kinder Gottes. Alles ist jetzt Gnade und deshalb kann alles zur Danksagung werden. Das ist die wunderbare und furchterregende Konsequenz von Ostern: Die Wirklichkeit – jede Wirklichkeit – kann, so wie sie ist, ein Anlass zum Glücklichsein werden, wenn wir es verstehen, sie in der Logik der Gemeinschaft mit den anderen und in Dankbarkeit zu leben.
Madeleine Delbrêl, eine Mystikerin des vergangenen Jahrhunderts, scheint dies gut verstanden zu haben, wenn sie in ihrem zu Recht berühmten Buch schreibt:
»Die Tatsache, dass wir uns dem Willen Gottes überlassen, übereignet uns gleichzeitig der Kirche, die durch eben diesen Willen ohne Unterlass zur Retterin und zur Mutter der Gnade gemacht wird. Jede fügsame Tat lässt uns in großer Freiheit des Geistes Gott ganz empfangen und Gott ganz geben. Dann wird das Leben ein Fest. Jede kleine Unternehmung ist ein gewaltiges Ereignis, in dem uns das Paradies geschenkt wird oder in dem wir selbst das Paradies verschenken können. Egal, was wir zu tun haben: ob wir einen Besen oder eine Füllfeder halten. Reden oder schweigen, etwas flicken oder einen Vortrag halten, einen Kranken pflegen oder auf der Schreibmaschine schreiben. All das ist nur die Rinde einer herrlichen Realität: der Begegnung der Seele mit Gott, die sich in jeder Minute erneuert, die in jeder Minute an Gnade zunimmt, die immer schöner wird für Gott. Es läutet? Schnell, aufgetan! Gott ist es, der uns lieben kommt. Eine Auskunft? … Bitte … Es ist Gott, der uns lieben kommt. Zeit, sich an den Tisch zu setzen? Gehen wir: es ist Gott, der uns lieben kommt. Lassen wir ihn gewähren« (Wir Leute von der Straße).
Nur ein Schatten bleibt, der uns daran hindern könnte, die Freude eines von der Angst vor dem Tod freien Lebens zu genießen: die naive Erwartung eines Lebens ohne Kreuz. Bevor Jesus zum Vater zurückkehrte, er-schien er verschiedene Male seinen Freunden und versuchte auch diesen dunklen Schatten zu erhellen.
»Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht« (Lk 24,25-27).
Die beiden Emmausjünger gehen traurig von Jerusalem weg. Der Auferstandene stößt zu ihnen und begleitet sie auf ihrem Weg, aber sie erkennen ihn nicht. Er lässt sie erzählen, er räumt ihnen das Recht ein, ihr Herz auszuschütten, mit ihrer bitteren Enttäuschung herauszurücken. Sie erinnern sich an alles, sogar an die Tatsache, dass der Leichnam Jesu nicht mehr im Grab liegt. Aber sie können nicht lächeln, denn sie hatten auf ein anderes Ende gehofft. Jesus hilft den beiden Jüngern, das große Geheimnis zu verstehen. Er hält eine lange Katechese, deren Worte uns nicht im Einzelnen, sondern nur dem Sinn nach überliefert sind: Das Leid an sich war nicht notwendig, aber es war notwendig, dass Christus leidet, um zu offenbaren, wie sehr und bis zu welchem Punkt Gott die Welt liebt.
»Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?« (Lk 24,30-32).
Die beiden Jünger merken es nicht sofort, sondern erst als sie mit dem geheimnisvollen Wanderer am Tisch sitzen. Genau in dem Augenblick, als sie mit ihm das Brot brechen, entdecken sie, dass in ihnen bereits die Hoffnung auf ewiges Leben und die Freude über die Auferstehung wohnt. Die große Überraschung dieser Erzählung besteht nicht so sehr in der Tatsache, dass die beiden Jünger Jesus nicht sofort erkannt haben, sondern darin, dass sie nicht bemerkt haben, dass trotz allem ihr Herz noch brannte.
Jeder Mann und jede Frau sind eingeladen, eine nicht weniger glühende Erfahrung von der Auferstehung zu machen: unter dem Staub oder der Asche der eigenen Geschichte die Existenz einer Glut zu entdecken, die Schmerz und Tod nicht auszulöschen vermochten. Eine Glut, bereit, neu entfacht zu werden, um die Seele zu entzünden und den Blick zu läutern, der fähig wird, in allem das Ostergeheimnis Christi zu erfassen.
Schluss
Mit seiner Auferstehung hat uns Jesus, der Herr, ein kostbares Vermächtnis hinterlassen. Denn es offenbart uns die Schätze, die in unserem Menschsein verborgen sind, wenn es sich vom Heiligen Geist nach Gottes Bild formen lässt und ihm so ähnlich wird. Diese Haltungen und Lebensweisen sollten nicht nur schwierigen Zeiten vorbehalten sein, wenn wir uns wieder aufrichten und den Weg wieder aufnehmen müssen. Christus hat seine Auferstehung nicht improvisiert, sondern sie im Laufe der Zeit vorbereitet, indem er lernte, jene inneren Haltungen zu leben, in denen in aller Stille der Same ewigen Lebens heranreift.
Indem der Herr Beziehungen bedingungsloser Liebe zu uns aufgebaut hat, versteht er, dass es sinnlos ist, sich zu ärgern, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant. Fruchtbarer ist es, den Weg der Begegnung wieder aufzunehmen, im Vertrauen darauf, dass es noch viel zu erleben und zu entdecken gibt.
Frei zu bleiben, auch in den schwierigsten Beziehungen, ist der einzige Weg, um durch echte Vergebung wieder Leben zu ermöglichen, eine Vergebung, die in der Lage ist, die durch Zeit und Sünde zerrütteten Bande zu heilen.
Nur so werden wir ohne Groll und Ressentiment zu Zeugen jener größeren Liebe, die weder die Wasser des Bösen noch der Tod auslöschen können. Die Kraft der Auferstehung steht in direktem Verhältnis zur Beharrlichkeit der Liebe: der Flamme, die der Herr in unsere Herzen eingeprägt hat, und Siegel eines ewigen Lebens schon in dieser Welt.
Gott Vater, der du durch deinen eingeborenen Sohn den Tod besiegt und uns den Weg zum ewigen Leben geöffnet hast, gib, dass wir, die wir die Auferstehung des Herrn feiern, im Licht des Lebens neu geboren werden, erneuert durch deinen Geist. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus.













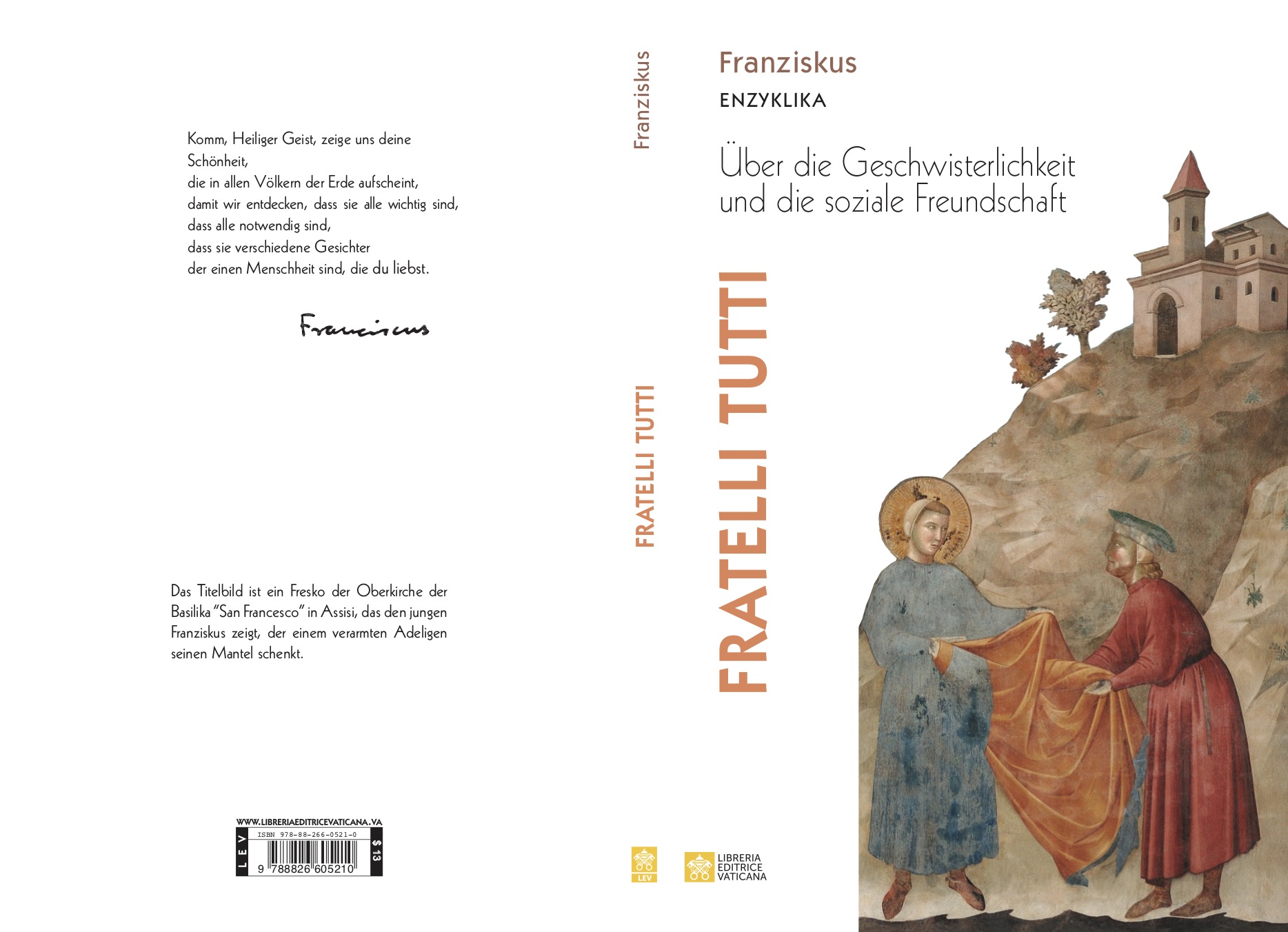 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
