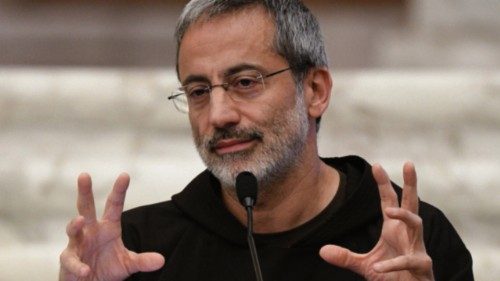
Am Freitagvormittag, 28. März, hielt der Kapuziner Roberto Pasolini die zweite Meditation in der Fastenzeit. In diesem Jahr kann jeder Interessierte dazu in die vatikanische Audienzhalle kommen. Die Meditationen stehen unter dem Thema »Verankert in Christus. Verwurzelt und gegründet in der Hoffnung auf das neue Leben«. Im Mittelpunkt der zweiten Betrachtung stand die Haltung tiefer, innerer Freiheit, wie sie im Leben Jesu sichtbar wird, das den Christen Vorbild sein soll.
Unser Weg durch die Fastenzeit hat das Ziel, zu prüfen, ob und wie tief unser Leben in Christus verankert ist, und zwar ausgehend von der Gabe der Taufe, die wir in der Kirche als Möglichkeit eines erneuerten Lebens empfangen haben. In der ersten Meditation haben wir die Szene der Taufe Jesu betrachtet, in der ein Zug unserer Menschlichkeit aufscheint, der schwer umzusetzen ist: die Bereitschaft das, was wir zum Leben brauchen, zu empfangen, anstatt es uns selbst zu beschaffen. Bei dieser zweiten Meditation soll unsere Aufmerksamkeit auf einige Begebenheiten aus dem öffentlichen Leben Jesu gerichtet sein, in denen eine weitere Haltung sichtbar wird, die unsere zu Bewegungsmangel – auch im geistlichen Sinne – neigende Mentalität selten zu schätzen weiß. Es handelt sich um die Fähigkeit, über die erreichten Ziele und Erfolge hinauszugehen, im Hinblick auf eine tiefe Freiheit sowohl uns selbst als auch den Menschen gegenüber, denen wir im Geist des Dienens begegnen. Dieser Aspekt tritt im öffentlichen Wirken Jesu ganz klar hervor, bis hin zu den Worten, in denen er selbst das Bewusstsein von seiner Sendung zum Heil der Welt offenbart.
Nach seinem ersten erfolgreichen Tag in Kafarnaum beschließt Jesus, nicht dort zu bleiben, sondern aufzubrechen. Er lässt sich weder vom Beifall der Menge noch von den Erwartungen der Jünger verlocken, während er im Gebet die Kraft findet, seiner Sendung treu zu bleiben: »Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde; denn dazu bin ich gekommen« (Mk 1,38). Nachdem Jesus die verletzte Menschheit geheilt hat, weist er die Illusion eines Mitleids zurück, das nach Beifall heischt. Sein Gebet befreit ihn von der Versuchung zur Allmacht und von der Notwendigkeit, immer verfügbar zu sein. So entlarvt er das Risiko, echtes Dienen und die Suche nach persönlicher Anerkennung miteinander zu verwechseln.
Ausgehend von dieser außergewöhnlichen Haltung, die mit verschiedenen Nuancen in zahlreichen Momenten seines Lebens aufscheint, wollen wir einige Begebenheiten Revue passieren lassen, bei denen die tiefe Freiheit Christi und seine Art und Weise, der Welt das Heil zu bringen, uns dazu zwingen, darüber nachzudenken und zu prüfen, ob und in wie weit unser eigenes Tun dem Evangelium entspricht.
1. Nicht sofort vertrauen
Das Wort Gottes ist auf eine überraschende Weise in die Realität und Komplexität des menschlichen Lebens eingetaucht und hat dabei ein sehr originelles, herausforderndes Persönlichkeitsprofil an den Tag gelegt. Es scheint, dass die in Jesus gegenwärtige göttliche Natur es nicht nötig hat, über die Schranken unserer menschlichen Natur hinauszugehen, um ihr ganzes Licht und ihre ganze Kraft freizusetzen. Um diese reiche, überzeugende anthropologische Qualität zum Ausdruck zu bringen, wollte Jesus den langsamen, gewöhnlichen Weg der Reifung gehen, denn »seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen« (Lk 2,52). Wachsen ist kein selbstverständlicher und automatischer Entwicklungsprozess, vielmehr ist dazu in hohem Maße die Fähigkeit erforderlich, die Umstände zu bewerten, und ebenso eine rigorose – aber nicht skrupulöse – Aufmerksamkeit für die Details. Indem Jesus sich diesen Anforderungen unterordnete, war er in der Lage zu wachsen und wurde zu einem einfachen Menschen, ohne jemals naiv zu sein. Im Gegenteil, sein sanftmütiges, demütiges und in der Wüste erprobtes Herz offenbart sich in den Evangelien als reifer und fruchtbarer Boden, fähig, mit der Komplexität der menschlichen Beziehungen umzugehen, ohne jemals etwas als selbstverständlich anzusehen, nicht einmal nur scheinbar grundlegende Tatsachen.
Nachdem Jesus im Johannesevangelium mit dem Zeichen bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-12) und mit einer sehr eindrücklichen prophetischen Geste im Tempel von Jerusalem (Joh 2,13-22) die Stunde seiner glorreichen Offenbarung vorweggenommen hat, schließt der Evangelist das Kapitel mit einer kurzen Bemerkung.
»Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen; denn er wuss-te, was im Menschen war« (Joh 2,23-25).
Die Art und Weise, wie Jesus auf die große Zustimmung, die sein Wirken hervorzurufen vermag, reagiert, kann uns nur irritieren. Wir alle freuen uns – ja, es schmeichelt uns –, wenn jemand unsere Handlungsweise schätzt und ihr Beifall zollt. In einer Kultur, in der die Werte des Individualismus und des zügellosen Wettbewerbs vorherrschen, sind wir überglücklich, wenn unsere Popularität plötzlich und deutlich zunimmt. Dieses Bedürfnis, ständig und schnell gewürdigt zu werden, veranlasst uns dazu, jedes Anzeichen der Wertschätzung, das uns entgegengebracht wird, bereitwillig anzunehmen: eine Auszeichnung, ein Like, ein Blick.
Jesus scheint von dieser Art der allzu schnellen und oberflächlichen Anerkennung Abstand zu nehmen. Gewiss, sobald er beginnt, sich der Welt zu offenbaren, bleibt das Faszinierende seiner Persönlichkeit nicht unbemerkt: Viele Menschen, die seine Zeichen sehen, beginnen, an ihn zu glauben. Dieser Vertrauensvorschuss scheint jedoch von Jesus nicht mit Begeisterung aufgenommen zu werden. Obwohl viele begonnen haben, ihm zu vertrauen, ist Jesus der Meinung, dass er sich noch niemandem anvertrauen kann.
Warum dieses Misstrauen? Steht diese Skepsis nicht im Widerspruch zur vertrauensvollen Offenheit, die Jesus in seinem Leben allen Menschen, sogar seinen Feinden gegenüber zeigen wird? Der Text sagt, dass Jesus sich so verhält, weil er das menschliche Herz gut kennt, weil er es ohne Abstriche angenommen hat und weil er es durch die Versuchungen in der Wüste bis in die Tiefe geprüft hat. Mit der Entscheidung für die Menschwerdung hat Jesus »entdeckt«, dass unser Herz zwar wunderbar ist, weil darin der Geist und die Stimme Gottes wohnt, dass es aber auch äußerst schwach, manipulierbar, unbeständig und ängstlich ist. Genau mit diesen Begriffen wird Jesus es beschreiben, wenn er der Menge zu erklären versucht, warum das Wort Gottes, das in den Menschen gesät wird, auf viele Hindernisse stößt, bevor es eine Frucht neuen Lebens bringt (vgl. Mk 4,14-20).
Jesus erliegt nicht der Versuchung einer oberflächlichen Komplizenschaft mit unserer unmittelbaren Zustimmung. Auf diese Weise offenbart er sich als Lehrmeister, der darauf achtet, nicht nur das zu geben, was uns Freude bereiten kann, sondern auch das, was gut ist für das Heranreifen echten Vertrauens. Jesus verzichtet darauf, sofort einladend seine Arme auszubreiten, um uns zu einer bewuss-teren und reiferen Antwort zu führen. Die Fähigkeit, nicht sofort unsere Verfügbarkeit zum Ausdruck zu bringen, sobald wir das Gefühl haben, erwünscht zu sein, ist ein wertvoller Hinweis für die Gestaltung unserer Beziehungen, vor allem wenn sie noch im Entstehen begriffen sind. Denjenigen, die sich uns vielleicht mit einer gewissen Begeis-terung nähern, nicht sofort zu viel Vertrauen und intime Freundschaft zu schenken, ist kein Zeichen von Kälte, sondern von Weisheit. Es ist Ausdruck eines tiefen Respekts vor uns selbst, vor dem anderen und vor dem, was wir vielleicht in Freiheit gemeinsam leben wollen. Wichtige Dinge brauchen Zeit, sie müssen mit Geduld angenommen und mit Engagement und Hingabe vorbereitet werden.
2. Auch enttäuschen können
Die Fähigkeit, dem Instinkt der Begeisterung in den Beziehungen nicht nachzugeben und darauf zu verzichten, das zu tun, was der andere von uns erwarten würde, kann uns auch sehr weit bringen. Die Volksweisheit lehrt uns bereits, dass es angebracht ist, mindestens bis zehn zu zählen, bevor wir auf die Impulse reagieren, die uns die Realität bietet. Wenn wir dieser Haltung auf den Grund gehen, können wir entdecken, dass unsere Menschlichkeit in der Lage ist, das Gute – vielleicht sogar das Beste – gerade dann hervorzubringen, wenn sie in der Lage ist, die an sie gerichteten Erwartungen zu enttäuschen.
»Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort« (Mt 15,21-23a).
Während seines Wirkens in Galiläa erkundete Jesus mitunter gerne die territorialen Grenzen Israels und drang in jene Gegenden mit gemischter Bevölkerung vor, wo häufig die interessantesten Dinge geschehen und die anregendsten Begegnungen stattfinden. Bei einer dieser Gelegenheiten tritt eine leidgeprüfte »heidnische« Frau vor Jesus, das heißt eine Ausländerin. Ihre Tochter leidet aufgrund eines unreinen Geistes unter großen inneren Qualen. Was diese Frau drängt, sich auf den Weg zu Jesus zu machen und um Aufmerksamkeit und Heilung zu betteln, ist zweifellos das Gefühl tiefen Mitleids gegen-über ihrer Tochter. Deshalb ist ihre Stimme ein Schrei, in dem angesichts einer gravierenden, unlösbaren Situation Verzweiflung und Angst zum Ausdruck kommen. Die Reaktion Jesu auf ihre demütige und vertrauensvolle Bitte ist nicht nur ungewöhnlich, sondern befremdlich: nicht einmal die Andeutung einer Antwort, auch nicht das Almosen eines Blickes.
»Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her! Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt« (Mt 15,23b-24).
Unsere Reaktion ist dieselbe wie die der Jünger. Wie ist die Gefühllosigkeit Jesu angesichts so großen Leids zu rechtfertigen? Wie ist die Enttäuschung, ja die Empörung über eine Reaktion zu verbergen, die nicht nur dem göttlichen, sondern schon dem menschlichen Mitgefühl zu widersprechen scheint, zu dem jedes Herz fähig sein sollte? Wenn wir aufmerksam auf die Bitte der Jünger hören, können wir neben dem anfänglichen Verständnis für sie in ihren Worten eine nicht ganz so reine Motivation erkennen. Die Bitte sofortigen Eingreifens ist nicht so sehr von der Nächstenliebe gegenüber der Frau motiviert, sondern vielmehr von dem Wunsch, nicht mehr von ihrem verzweifelten Schrei gequält zu werden: »Schick sie fort [In der ital. Version heißt es in wörtlicher Übersetzung: Erhöre sie], denn sie schreit hinter uns her!«
Häufig ist dies der Grund, warum wir schleunigst aktiv werden, wenn uns ein Hilferuf erreicht. Wir legen sofort und gern das Gewand des Retters an, nicht weil uns die Situation des Notleidenden wirklich am Herzen liegen würde, sondern weil wir uns wichtig fühlen, wenn wir hilfsbereit die Hand ausstrecken, und uns das beruhigt angesichts der Bedrohungen, die in der Wirklichkeit verborgen sind.
Die Antwort Jesu dagegen ist demütig und gelassen. In aller Einfachheit erklärt er, dass auch seiner bedingungslosen Bereitschaft, ein Werkzeug des Mitleids in den Händen Gottes zu sein, gewisse Grenzen gesetzt sind. Jesus hat keine Angst, seinem eigenen Wunsch, den Nächsten zu lieben und ihm zu dienen, Grenzen zu setzen, weil er völlig frei ist von der Befürchtung, unnütz oder unbedeutend zu erscheinen. Wir alle wollen wie die Jünger in Eile handeln, um den schlimmen Verdacht aus der Welt zu schaffen, dass wir im Grunde nicht gebraucht werden. Paradoxerweise vermag Jesus – der Retter der Welt – gerade deswegen Rettung zu bringen, weil er es nicht nötig hat, zu »spüren«, unbedingt notwendig zu sein, sondern immer und bloß nützlich. Denn die scheinbar grausame, gleichgültige Reaktion Jesu gibt der Frau die Gelegenheit, ihre Verzweiflung und ihre Sehnsucht nach Leben wirklich voll und ganz zum Ausdruck zu bringen.
»Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr! Aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen« (Mt 15,25-27).
Wenn wir nicht schnell ernstgenommen werden, dann neigen wir alle dazu, uns leicht zu empören, indem wir uns auf uns selbst zurückziehen und die Opferrolle einnehmen. Angesichts der stummen Zurückweisung durch Jesus verschließt diese Frau sich nicht in ihrem Stolz, sie verliert nicht den Mut und gibt die Hoffnung nicht auf. Vielmehr nähert sie sich Jesus hartnäckig und nennt mit großer Würde erneut die Not beim Namen, völlig ohne Angst oder falsche Scham. Angesichts dieser bewundernswerten Freiheit entschließt sich Jesus, zu ihr zu sprechen und ihr den Grund für seine Gleichgültigkeit genau zu erklären: Er ist gekommen, um vor allem die Kinder Israels zu erlösen, nicht die Fremden. Im Sprachgebrauch jener Zeit war mit den »kleinen Hunden« die heidnische Bevölkerung gemeint, die nicht dem Geschlecht und Glauben Israels angehörten. Die Frau lässt sich von diesem Einwand nicht beeindrucken, sondern stellt ihn in den Zusammenhang einer umfassenderen Sichtweise. Indem sie sich mit einem kleinen Hund vergleicht, der voll Vertrauen unter dem Tisch mit dem Schwanz wedelt, zeigt sie ihren Glauben, dass in Christus das Reich Gottes jedem nahe ist. Denn es ist nicht die Quantität, sondern die Qualität der Gegenwart Gottes, die den Unterschied ausmacht.
»Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt« (Mt 15,28).
In den Augen Jesu sind diese Worte nichts weniger als eine großartiger Ausdruck jenes Glaubens, der in der Lage ist, zu heilen und zu retten. Ein Glaube, der nicht nur die in seiner Person verborgene Göttlichkeit erkennen, sondern auch hoffen kann, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. In der Tat ist es nicht einmal Jesus, der ein Wunder vollbringen muss: der demütige und gläubige Wunsch der Frau reicht aus, um die Realität der Dinge zu verändern. Die Gleichgültigkeit Jesu hat sich also in eine raffinierte Pädagogik verwandelt, die die kostbare Perle im Herzen dieser Frau zum Vorschein bringt. Sie steht zwar außerhalb der Verheißungen Israels, ist aber dem Vertrauen, dass ein Mehr an Leben noch möglich ist, keineswegs fremd.
3. Nichts einfordern
Eine besondere Art des Gleichmuts kommt auch in der Fähigkeit Jesu zum Ausdruck, sich vom Konsens der Menge zu distanzieren. In allen Evangelien wird die Episode der Vermehrung der Brote und Fische erzählt, wenn auch mit unterschiedlichen erzählerischen und theologischen Nuancen. Im vierten Evangelium wird die große Begeisterung hervorgehoben, die das Zeichen Christi bei den Anwesenden auszulösen vermochte.
»Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll« (Joh 6,14).
Die Menge hat das Wunder gesehen, aber wie Jesus später sagen wird, hat sie es noch nicht als bedenkenswertes Zeichen erkannt. Alle sind glücklich, aber nicht weil sie in der Vermehrung der Nahrung eine von Gott kommende Herausforderung wahrgenommen hätten, sondern weil jeder mit vollem Bauch nach Hause gehen kann: »Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid« (Joh 6,26). Jesus wird demnach als Prophet des Höchsten anerkannt, weil er in der Lage ist, die Wirklichkeit rasch zu verändern, indem er die von ihr gesetzten Grenzen aufhebt. Aber das Zeichen sollte noch viel mehr bedeuten. Die Botschaft war schöner, ja sogar prophetischer, weil sie
etwas enthüllen wollte, das nicht nur Gott mög-lich ist, sondern auch uns.
Wir alle dürfen hoffen und glauben, dass der Herr die Wirklichkeit mit seiner Gnade bereichert. Aber es fällt uns schwer zu glauben, dass unsere ärmlichen Ressourcen Nahrung werden können, um den Hunger vieler zu stillen. Die Vermehrung der Brote und Fische ist nicht nur eine Offenbarung Gottes, sondern enthüllt auch, was unsere Menschennatur durch Christus sein kann. Es ist eine frohe Botschaft, die unsere Hoffnung vergrößert und unsere übliche Haltung überwindet, uns für unbedeutend zu halten,
immer angewiesen auf Unterstützung von außen.
Im Grunde genommen ist es gerade dieser resignierende Blickwinkel, der uns zu Menschen macht, die leicht zu manipulieren sind und sich von jeder Art von Einfluss oder Influencer in Beschlag nehmen lassen. Jesus kennt diese innere Schwäche sehr gut, die weder auf oberflächliche noch auf entmündigende Weise ausgeglichen werden darf. Daher weiß er, wann die Zeit gekommen ist, einen Schritt zurück zu treten, indem er uns der Mühe aussetzt, wieder neu zu glauben, auch an uns selbst.
»Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein« (Joh 6,15).
Den Jüngern fällt es schwer, die Zurückhaltung Jesu zu verstehen. Nachdem sie vergeblich auf ihn gewartet haben, beschließen sie bei Einbruch der Nacht, den Heimweg alleine anzutreten; vielleicht sind sie auch enttäuscht von seinem Verhalten. Aber bei der Überfahrt über den See von Galiläa wird die Nacht stürmisch und heftiger Wind kommt auf. Was um sie herum geschieht ist ein Spiegel ihres inneren Tumults, der sie aufwühlt: der Versuch, sich von Jesus zu entfernen, hat sie einem viel tiefergehenden »Unwetter« ausgesetzt:
»Als sie etwa fünfundzwanzig oder dreißig Stadien gefahren waren, sahen sie, wie Jesus über den See kam und sich dem Boot näherte; und sie fürchteten sich. Er aber rief ihnen zu: Ich bin es; fürchtet euch nicht!« (Joh 6,19-20).
Mitten in der Nacht erscheint Jesus den Jüngern wie ein Gespenst. Aber die wahren Gespenster sind sie selbst, denn sie sind immer noch Gefangene der Angst und unfähig, die in ihrer Schwäche verborgene Stärke zu erkennen. Erst im Morgengrauen, als sie die Sehnsucht wiederentdecken, ihn bei sich zu haben, beruhigt sich der Sturm. Das ist auch eine Hoffnung für uns: In den dunkelsten Nächten, wenn jeder Hafen weit entfernt zu sein scheint, reicht es aus, seine Gegenwart zu ersehnen, um den Frieden wiederzufinden.
»Sie wollten ihn zu sich in das Boot nehmen, aber schon war das Boot am Ufer, das sie erreichen wollten« (Joh 6,21).
Wenn man es genau nimmt, sagt Johannes nicht, dass Jesus in das Boot gestiegen ist, sondern dass die Sehnsucht der Jünger, ihn zu sich zu nehmen, sie zum Ziel geführt hat, das sie für unerreichbar hielten. Sicherlich können wir uns vorstellen, dass Jesus wirklich ins Boot gestiegen ist, wie es die anderen Evangelien erzählen. Aber was mehr zählt, ist, zu verstehen, dass unser Heil nicht von seiner sichtbaren Gegenwart abhängt: Es reicht, die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit ihm wiederzufinden, damit sein Licht unsere Finsternis wieder erleuchten kann.
Am Tag nach dem nächtlichen Sturm versucht Jesus, ihnen den tiefen Sinn der Tatsache der vermehrten Brote und Fische zu vermitteln, indem er ihnen erklärt, dass physischen Hunger zu stillen das eine ist, es aber etwas anderes ist, zu lernen, jene Speise zu kosten, die zum ewigen Leben führt.
»Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt« (Joh 6,51).
Was Jesus sagt, erscheint auch uns heute unglaublich und schockierend zu sein. Nach zweitausend Jahren Christentum, nach schlimmen Spaltungen innerhalb der Kirche (auch) in Bezug auf das Geheimnis des zu Jesu Gedächtnis gebrochenen Brotes, müssen wir erkennen, dass es sehr herausfordernd ist, eine Beziehung zu einem Gott zu akzeptieren, der uns nicht nur Dinge geben will, sondern sogar sich selbst.
Ein befehlender Gott wäre einfacher zu akzeptieren als ein Gott, der sich selbst als Nahrung anbietet, um uns wiederum in Liebe und Nahrung für andere zu verwandeln. Die Sünde drängt uns zum Überleben, während das Wort Christi uns empört, weil es uns zu einem Leben der Selbsthingabe auffordert. Das ist der große Stein des Anstoßes, hervorgerufen vom Symbol des Brotes und vom Geheimnis der Eucharistie: bedingungslos geliebt zu werden, bedeutet, sich der gegenseitigen Liebe nicht entziehen zu können. Im Leib Christi sind wir Kinder Gottes und dazu berufen, als Brüder und Schwestern zu leben. Angesichts einer so großen Bestimmung ist es nur natürlich, zu befürchten, dass wir ihr nicht gerecht werden.
»Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher« (Joh 6,66).
Nicht wenige, nicht einige, sondern viele von denen, die versuchten, auf ihn zu hören und ihm zu folgen, entschieden an jenem Tag, als sie diese Worte hörten, die Nachfolge aufzugeben. Bibelverse wie diese geraten in Vergessenheit oder werden abgeschwächt durch unsere Gewohnheit, uns nur an nützliche Ergebnisse und Erfolge zu erinnern. Jener Moment im Leben Jesu sollte dagegen sehr aufmerksam in Erinnerung bewahrt und meditiert werden. Nicht nur, um ein authentischeres Bild des Antlitzes zu bewahren, das Gott in Christus offenbaren wollte. Sondern auch, um jene – zahlreichen – Episoden des Lebens deuten und akzeptieren zu können, in denen unser Versuch, uns so zu zeigen, wie wir sind, und uns im Angesicht der anderen zu verstehen, nicht von Beifall und Anerkennung gekrönt werden.
Versagen und Misserfolg sind die besten Verbündeten für ein gesundes und heiliges Wachstum unserer Menschlichkeit. Vor allem weil sie bestätigen, dass eine wahre Gemeinschaft des Denkens und Handelns sich nicht auf ein oberflächliches Gefühl beschränken kann, sondern Frucht eines langen Weges der Auseinandersetzung, des Austauschs ist, der auch durch Zeiten der Enttäuschung und Differenzierung geht. Zweitens sind Momente, in denen wir Zurückweisung von anderen erfahren, hilfreich, um nicht nur Bilanz zu ziehen hinsichtlich dessen, was wir sind, sondern auch in Bezug auf das, was wir zu sein bereit sind.
»Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen?« (Joh 6,67).
Ohne zu zögern, ohne zuzulassen, dass Schweigen und Murren die bereits extrem angespannte Atmosphäre vergiften, wendet sich Jesus an die Zwölf, seine engsten Vertrauten, um ihnen eine große Freiheit zu schenken, die sie sich allein nicht zu nehmen gewusst hätten. In den Worten Jesu liegen weder Ironie noch Erpressung, nur die große Entschlossenheit eines Menschen, der keine ständige Bestätigung braucht, um seinen Weg weiterzugehen. Jesus scheint bereit zu sein, sogar die Nähe seiner Freunde zu verlieren, um die aufgrund seiner Lebensentscheidung eingeschlagene Richtung nicht aufzugeben. Es handelt sich nicht um Gefühllosigkeit gegenüber den anderen, sondern um eine tiefe innere Freiheit, die sich in der Stärke auszudrücken weiß, von keinem anderen – au-ßer sich selbst – zu verlangen, den vollen Preis für die eigene Sehnsucht zu zahlen.
Wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass Jesus den Imperativ immer seltener verwendet. In den ersten Zeiten der Nachfolge wagt es Jesus, sich mit einer nachdrücklichen, eindringlichen Aufforderung, von der eine besondere Faszination ausgeht, an Männer und Frauen zu wenden, die auf der Suche nach Gott sind: »Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen« (Mt 4,19). Später, in Zeiten der mühevollen Treue zum Weg der Nachfolge, wird es notwendig sein, die Ausdrucksweise zu ändern, in dem Bemühen, nicht erzwungene Übereinstimmung zu erreichen, sondern freie Zustimmung: »Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach« (Mt 16,24). Auf den Nachdruck des Imperativs folgt der Übergang zur Behutsamkeit einer Möglichkeit, sicherlich nicht, um den Einsatz zu verringern, sondern damit allein die Anforderungen einer freien, bewussten Liebe im Mittelpunkt stehen.
Diesem Thema der Verantwortung widmet Jesus eine seiner Lehren in Form eines Gleichnisses, während er auf sein Pascha zugeht. In dem Bemühen, einen auch zu seiner Zeit vorherrschenden Moralismus anzuprangern, veranschaulicht Jesus die Forderungen des Evangeliums anhand einer sehr einfachen Geschichte, in der ein Vater und zwei Söhne vorkommen.
»Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg! Er antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging hinaus. Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ja, Herr – und ging nicht hin« (Mt 21,28-30).
Ein Detail fällt sofort auf: keiner der beiden Söhne will wirklich im Weinberg des Vaters arbeiten. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Der erste hat den Mut, es zuzugeben, während der zweite sich für eine Lüge entscheidet, um den Vater zufriedenzustellen. Die Aufrichtigkeit des ersten öffnet den Weg zur Reue, während die Verstellung des zweiten sich als zum Scheitern verurteilte Illusion erweist, bei der alles bleibt, wie es war. Von diesem Bild ausgehend offenbart Jesus, was Gott wirklich am Herzen liegt.
»Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der erste. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch: Die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt« (Mt 21,31-32).
Der himmlische Vater verlangt nicht, dass seine Kinder immer bereit sind, flink seinen Willen zu tun. Er ist kein unnachgiebiger Gott, unfähig, in seinem Schöpfungsplan Unvollkommenheiten zu tolerieren und mit ihnen umzugehen. Wenn ihn jedoch etwas verletzt und ihm Sorge bereitet, dann sind es Kinder, die nicht frei genug sind, um ihre Empfindungen, ja sogar ihre Verweigerung zu äußern. Denn wenn wir uns hinter nutzloser Selbstgefälligkeit verbarrikadieren, werden wir zu Sklaven unserer selbst und der Erwartungen, von denen wir glauben, das andere sie an uns haben. Wenn wir den Mut haben, aufrichtig zu sagen, was wir denken und wünschen, sind wir bereits auf dem Weg, unsere Grenzen zu überwinden und uns für ein größeres Leben zu öffnen. Wir mögen in den Augen der anderen – und vielleicht auch in unseren eigenen – nicht perfekt sein, aber wir werden dem Reich Gottes mit Sicherheit näher sein.
Schluss
Unser Wunsch, in Christus verankert zu bleiben, muss sich in dieser Zeit des Heiligen Jahres mit unserer Fähigkeit auseinandersetzen, das Evangelium auch in seinen weniger offensichtlichen, weniger unmittelbaren Aspekten zu leben. Indem Christus das Werk des Vaters vollbrachte und in seiner und unserer Menschlichkeit den Zügen seiner väterlichen und universalen Liebe Ausdruck verlieh, offenbarte er uns einige Formen, welche die Liebe zu wählen und anzunehmen weiß.
Vor allem die Fähigkeit, Beziehungen heranreifen zu lassen, indem man die für ihre Entwicklung und ihren Ausdruck notwendige Zeit respektiert, ohne der Versuchung nachzugeben, allzu schnell zu vertrauen. Das bedeutet nicht, Beziehungen auf den Zweifel zu gründen, sondern Klugheit und schrittweises Vorgehen zu pflegen, grundlegende Haltungen, damit unsere Freiheit echte und dauerhafte Entscheidungen treffen kann.
Dieser Haltung entspringt auch die Kraft, die Erwartungen anderer enttäuschen zu können, nicht aus Verachtung oder um Wünsche zu unterdrücken, sondern um authentische Begegnungen in Freiheit zu ermöglichen und das Risiko zu vermeiden, subtilen Dynamiken gegenseitiger Manipulation zum Opfer zu fallen.
All dies führt uns zu einem weiteren Aspekt, der die Achtung unserer Freiheit und der der anderen zum Ausdruck bringt, nämlich die Entscheidung, von den anderen niemals etwas einzufordern. Wahrheit und Liebe haben es nicht nötig, sich aufzuzwingen, sondern vermögen zu warten und Dinge heranreifen zu lassen, bis sie die Frucht einer freien, vollen Zustimmung sind. So hat Gott die Welt gerettet, in der wir leben, und er tut dies auch weiterhin auf diese Weise.
Gott, unser Vater, der du uns in Christus, deinem lebendigen Wort, das Vorbild des neuen Menschen geschenkt hast, bewirke, dass der Heilige Geist uns lehre, auf sein Evangelium zu hören und es in die Tat umzusetzen, damit die ganze Welt dich erkennt und deinen Namen verherrlicht. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus.













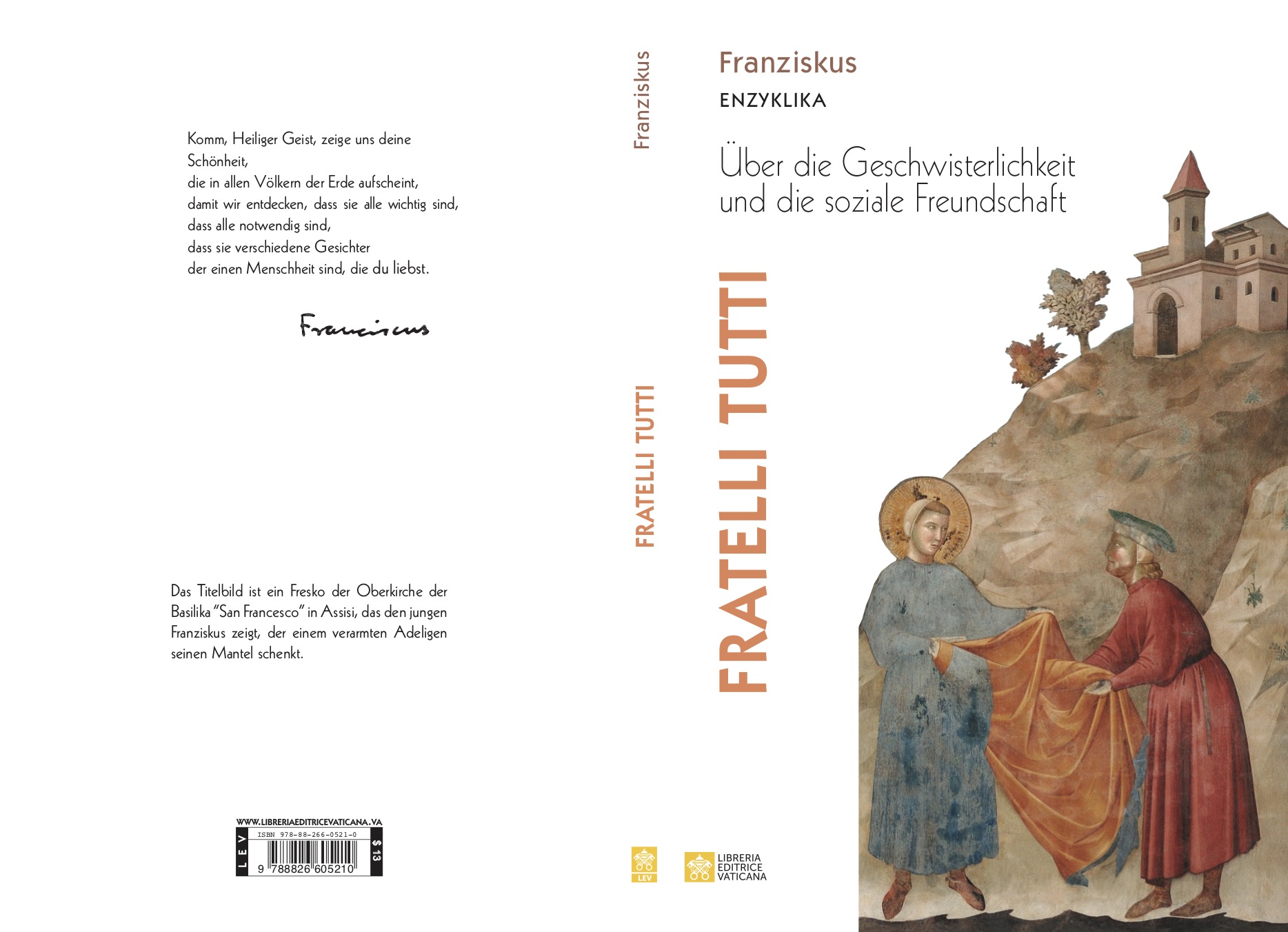 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
