
Von Dr. Heinz Wieser
Seit Beginn des Jahres 2025 trägt neben dem deutschen Chemnitz eine weitere Stadt den Titel »Kulturhauptstadt Europas«: Nova Gorica, die jüngs-te slowenische Stadt, die historisch und im alltäglichen Leben eng mit dem auf der italienischen Seite der Grenze gelegenen Gorizia (deutsch: Görz) verbunden ist. Nova
Gorica hat gemeinsam mit Gorizia seine Aktivitäten als Europäische Kulturhauptstadt am 8. Februar aufgenommen und beide Städte wollen das Jahr dafür nutzen, sich zusammen weiter zu entwickeln und so zu einer »Kulturhauptstadt Europas ohne Grenzen« zu werden. Dies wird auch eine Gelegenheit sein, das Konzept der Grenzen in vielen Dimensionen mit kulturellen und künstlerischen Mitteln zu erkunden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Görz geteilt: Der eine Teil gehörte nun zum ehemaligen Jugoslawien und heutigen Slowenien und hieß fortan Nova Gorica, der andere Teil, Gorizia, weiterhin zu Italien. Eine Mauer wurde errichtet, mitten durch die Piazza Transalpina. Familien wurden auseinandergerissen, Liebesbeziehungen zerstört. Der 1947 in Paris unterzeichnete Vertrag verlief wie eine Linie zwischen Küchen und Wohnzimmern. Umso schöner, dass nun beide Teile gemeinsam Kulturhauptstadt Europas sind. Doch man kann unmöglich durch die Straßen laufen, ohne all die aufgerissenen Wunden zu spüren.
Bewegte Geschichte
Die bewegte Geschichte von Görz spiegelt sich am besten wider an der Piazza della Vittoria mit der Sant’Ignazio-Kirche. Architektonische Schmuckstücke erinnern hier an vieles gleichzeitig: das Mittelalter, die Renaissance, die Zeit der Habsburger und später der Faschisten unter Mussolini. Dann wiederum stößt man auf versteckte Perlen wie etwa den Palazzo Lantieri aus dem 14. Jahrhundert.
Die Stadt Görz, linksufrig am Isonzo, ist Sitz des Erzbistums und Hauptort der gleichnamigen Provinz. Nur wenige Städte Mittel-europas wirken heute noch so »altösterreichisch«, ja geradezu »theresianisch«. Auf Grund der langen gemeinsamen Geschichte pflegt die Dolomitenstadt Lienz seit 25 Jahren mit der italienischen Stadt Gorizia eine Städtepartnerschaft.
Das gesamte Innergörz und damit auch der Hauptort bzw. die Residenzstadt Görz lag im Bereich des Patriarchates von Aquileia. Nach Unterwerfung des Patriarchenstaates (»Patria«) unter die Republik Venedig im Jahr 1420 änderte sich daran nichts. Bei der Besetzung des Patriarchenstuhles kam es besonders nach 1500 aber immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Venedig und Habsburg, vor allem weil sich die geistliche Gerichtsbarkeit auch auf den Klerus im österreichischen bzw. habsburgischen Teil Friauls bezog. Es entbrannte auch ein Streit über das Präsentationsrecht der Görzer bzw. ihrer Nachfolger über viele Pfarren.
Die Streitigkeiten wurden beendet, indem Papst Benedikt IV. das Patriarchat Aquileia aufhob und am 18. April 1752 einen Erzbischof in Udine für den venezianischen und einen in Görz für den habsburgischen Teil Friauls einsetzte.
Der wichtigste Sakralbau in der Stadt Görz ist die Domkirche zu den Heiligen Hilarius und Tatianus (Ilario e Taziano): Erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts schritt die Gemeinde an die Erbauung einer größeren Kirche, nachdem Görz, bisher pfarrlich zu Salcano (Solkan) gehörend, um 1460 zu einer selbstständigen Pfarre erhoben wurde. Der Ausbau zu einer dreischiffigen Kirche erfolgte erst ab 1654. Seit 1752 ist sie die Domkirche des Erzbischofs von Görz.
Der Überlieferung nach soll Antonius von Padua, vom Görzer Grafen Meinhard II. berufen, im Jahr 1225 eine kleine Kirche gegründet haben, geweiht der heiligen Katharina von Siena. Später erfolgte die Ausweitung zu einem Franziskanerkloster (Minoritenklos-ter). Nach der Zerstörung im Jahr 1800 sind vom historischen Baukomplex nur noch Wandelgänge auf der Piazza S. Antonio erhalten.
Der markante Baukomplex des Franziska-nerklosters Castagnavizza (Kostanjevica) mit der Kirche zu Mariae Verkündigung, heute in Nova Gorica auf slowenischem Boden gelegen, wurde von Graf Heinrich Matthias von Thurn im Jahr 1623 als Karmelitenkloster gegründet; 1811 wurde es dem Franziskaner-orden übergeben. Sant’Ignazio ist eine Kirche des Jesuitenordens. Der Renaissancebau entstand ab 1654, während die Fassade mit den zwei seitlichen Türmen erst nach 1720 errichtet wurde.
Die Grafen von Görz gehörten vom
12. Jahrhundert bis zum Ende des Mittel-alters zu den wichtigsten Fürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ihre Besitztümer reichten vom heutigen Kroatien über Slowenien und Kärnten bis nach Tirol. Ihr Herrschaftsgebiet erstreckte sich demnach über den größten Teil der heutigen Region Alpen-Adria. Die Residenzen waren Görz, Lienz, Schloss Tirol bei Meran und Innsbruck; der bedeutendste Vertreter Meinhard II. von Tirol-Görz, der 1271 mit seinem Bruder Albert I. die Besitzungen teilte und 1286 von König Rudolf I. zum Herzog von Kärnten erhoben wurde. Sein Sohn Heinrich wurde zum König von Böhmen gewählt, von den Luxemburgern jedoch wieder nach Kärnten-Tirol zurückgedrängt. Mit der berühmten Margarete »Maultasch« (gest. 1369) erlosch die »meinhardinische« Linie der Görzer in Tirol, während die »albertinische« bis zum Tod des Grafen Leonhard (gest. 1500) fortbestand. Die Vertreter der Dynastie standen in vielfältigen Beziehungen zu den Kaisern – insbesondere den Hohenstaufen, Habsburgern und Luxemburgern – und Päpsten, aber auch zu den Königen von Böhmen, Frankreich und Ungarn, den Herzögen von Österreich-Steiermark, Kärnten und Bayern, aber auch den Patriarchen von Aquileja, den Erzbischöfen von Salzburg, der Republik Venedig und den Herren von Mailand, Mantua und Treviso. Ihr Territorium bildete einen Passstaat, der den Handel von Deutschland nach Italien kontrollierte, ein bedeutendes Münzsystem schuf, Bergbau, Gewerbe und Künste förderte und das Geschehen im Alpenraum für Jahrhunderte mitbestimmte.
Bis zum Jahre 1500 regierte noch immer ein Reichsfürst die Gebiete vom Isonzo über Oberdrauburg und Lienz bis Bruneck, Graf Leonhard von Görz, der ohne Erben starb. Das Jahr 1500 brachte den Sieg der Franzosen über Kaiser Maximilian I. Was aber für den Kaiser erfreulicher war: dieses Jahr brachte den Landbesitz der Görzer, wobei die Vordere Grafschaft Görz, also das Gebiet im Pus-tertal und an der oberen Drau und Gail, mit der Grafschaft Tirol vereinigt wurde. Residenz dieser Vorderen Grafschaft Görz wurde Schloss Bruck am Eingang in das Iseltal, das die Grafen von Görz im frühen 13. Jahrhundert als Sperre erbaut hatten. Mit Graf Leonhard von Görz starb 1500 das Haus der Görzer aus. Sein Erbe war drei Jahre früher nur mündlich und ungefähr vereinbart worden. Nach Leonhards Tod, des letzten Grafen auf Schloss Bruck also, war Maximilian I. mit seinen Truppen rascher als die Gegner, in ers-ter Linie die Söldner Venedigs. Der Kaiser besetzte das Gebiet der Grafschaft Görz. Erst jetzt wurde die endgültige Grenze zwischen Tirol und Kärnten festgelegt, denn der Görzer war auch Pfalzgraf von Kärnten. Zwangsläufig wandte sich der Kaiser, zurückgedrängt von den Franzosen, Italien zu. Der weit verstreute Landbesitz der Görzer war jetzt plötzlich zum entscheidenden Sprungbrett nach Italien geworden. Am Isonzo wurden die Söldner Venedigs aufgehalten.
Görz und Tirol
In Sillian ließ Maximilian I. Schloß Heinfels zur Festung ausbauen. Der kriegerische Sturm blieb ihr erspart, doch ist sie ein Denkmal der umstrittenen Inbesitznahme des heutigen Osttirol durch Habsburg. Graf Leonhard heiratete im November 1478 Paola von Gonzaga aus Mantua, die Tochter des Markgrafen Lodovico in Bozen in Gegenwart Herzog Sigmunds des Münzreichen von Tirol. Graf Leonhard hoffte auf Nachkommenschaft, die ihm Paola jedoch nicht schenken konnte. Im August 1479 wurde zwar von der Geburt eines Mädchens berichtet, das aber, zu früh zur Welt gekommen, nach der Taufe gestorben sei. 1495 ist schloss Paola die Augen. Graf Leonhard von Görz-Tirol erlebte gerade in seinen letzten Lebensjahren viel Kummer und manche Enttäuschung. Mit vorgerücktem Alter wurde er kränklich. Als er am 12. April des Jahres 1500 auf Schloß Bruck gestorben ist, war dies ein Schicksalsschlag von weitreichender Bedeutung, da mit Graf Leonhard das alte und einst so mächtige Geschlecht der Gör-zer ausstarb, das görzische Territorium als politisches Gebilde aufhörte zu existieren und Lienz seine zentrale Position einer Residenzstadt verlor. Leonhard zu Ehren ließ Kaiser Maximilian I. in der Lienzer Stadtpfarrkirche St. Andrä vom Bildhauer Christoph Geiger den prächtigen Grabstein meißeln, der um 1505 fertig war und der jetzt wieder ähnlich wie vor 400 Jahren aufgestellt ist.
Maximilian, der auch Landesfürst sowohl von Tirol als auch von Kärnten war, dürfte von vornherein geplant haben, die Herrschaft Lienz mit Tirol zu vereinigen. Und auch die Bevölkerung tendierte Tirol zu. Immer mehr hatte sich das Pustertal politisch, wirtschaftlich und kulturell nach Westen hin ausgerichtet, nach Tirol und der Bischofsstadt Brixen als einem geistigen und kulturellen Zentrum. Das Pustertal war in den vergangenen Jahrhunderten der Görzer Herrschaft zu einer Einheit zusammengeschmolzen. Die Wünsche der Bevölkerung des ehemaligen gör-zischen Pustertales artikuliert zu haben, ist vorwiegend das Verdienst der Lienzer Bürger. Mit Schreiben vom 18. August 1500 richteten sie an Maximilian den ausdrücklichen Wunsch, mit Tirol vereinigt zu werden. Die Bestätigung der Freiheiten und Privilegien der Stadt Lienz durch Maximilian erfolgte am 17. September 1500. Mit Genugtuung dürfte man die Entscheidung Maximilians vom
1. März 1501 aufgenommen haben, womit alle Ämter zu Lienz und im Pustertal in das tirolische Kammermeisteramt zu Innsbruck einzubeziehen seien, die unterhalb Lienz zum Viztumamt in Kärnten. Mit der Einbeziehung des Pustertales und somit auch der Herrschaft Lienz in die Defensionsordnung der Grafschaft im Jahre 1511 war der Anschluss an Tirol faktisch vollzogen.
Im heutigen Bezirk Lienz und im Südtiroler Teil des Pustertales wohnt nach wie vor ein fleißiger Menschenschlag, der sich als Bergbauernschlag seit über tausend Jahre unter härtesten Umweltbedingungen bewährte, der handwerklich begabt ist, der Tirol und Österreich viele bedeutende Künstler und Wissenschaftler schenkte. Leider war Osttirol mit Südtirol jener Landesteil, der die Hauptlast des Ausganges des Ersten Weltkrieges und der Zerreißung des Landes zu tragen hatte. Die menschliche, kulturelle und wirtschaftliche Einheit des Pustertales und eine großen Siedlungs- und Wirtschaftsregion, deren Zentren Bruneck und Lienz hießen, ist zerschlagen worden. Die vor mehr als 150 Jahren gebaute Pustertal-Bahn von Franzensfeste nach Laibach hatte vor dem Ersten Weltkrieg Handel und Wandel entlang der ganzen Strecke immer dynamischer befruchtet. Sie verlor naturgemäß an Bedeutung. Osttirol – eigentlich ja ein Teil Südtirols – war von seinem wichtigs-ten Wirtschaftsraum abgeschnitten, und die bahnmäßige Verbindung mit Nordtirol und der Landeshauptstadt erfolgte durch »Korridorzüge«. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg leistete das Land Tirol im Bezirk Lienz von der ersten Stunde an aufwendigste Entwicklungsarbeit, die in einem Gebiet, das auch heute noch von allen österreichischen Bezirken den höchsten Anteil in der Landwirtschaft Tätigen an der Gesamtbevölkerung hat, vor allem der bäuerlichen Bevölkerung zugute kam. Die Erschließung von Berghöfen durch Güterseilbahnen, Güterwege- und Straßenbau, Wildbach- und Lawinenverbauungen usw. sicherten nicht nur die bäuerliche Mindestexistenz, sondern schufen auch die Grundlagen für den Fremdenverkehr.













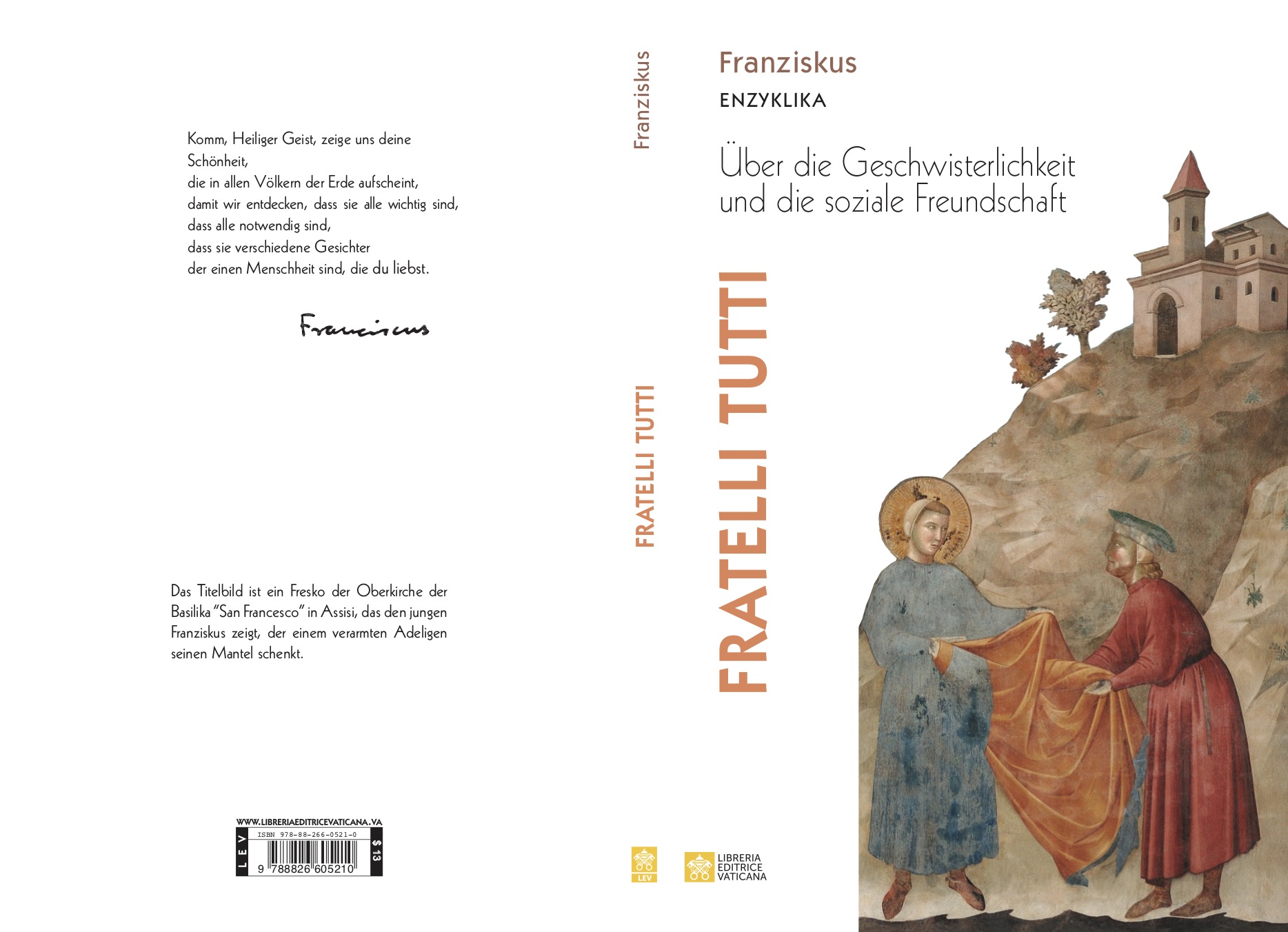 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
