
Von Andrea Monda
»Es ist wichtig, zuzuhören. Wir müssen uns bewusst machen, dass Kinder beobachten, verstehen und sich erinnern. Und mit ihren Blicken und ihrem Schweigen sprechen sie zu uns. Hören wir ihnen zu!« Mit diesem Appell beendete Papst Franziskus am 3. Februar seine Ansprache auf dem Weltgipfel für Kinderrechte, ein Appell, den er in seinem Schlusswort am Nachmittag wieder aufgriff: »Pater Faltas hat ein Wort, einen Satz gesagt, den ich sehr mag: ›Die Kinder beobachten uns.‹ Es war auch der Titel eines berühmten Films. Die Kinder beobachten uns: Sie beobachten uns, um zu sehen, wie wir im Leben vorange.«
Franziskus bezieht sich auf den Film von Vittorio De Sica aus dem Jahr 1943 mit genau dem Titel »I bambini ci guardano« (Die Kinder beobachten uns), der eine einfache, aber große Wahrheit offenbart: Sie schauen uns zu, sie beobachten uns. Und da es stimmt, was Flannery O’Connor bemerkte, dass »die Menschen zu dem werden, was sie sehen«, spielt das Spektakel des Lebens, das die Erwachsenen vor den Augen der Kleinen aufführen können, eine grundlegende Rolle für ihr Leben. Daher das Thema der großen Verantwortung, die auf den Schultern der Eltern ruht.
Es muss hinzugefügt werden, dass ein Heranwachsender feststellen wird, dass das Leben immer wieder Überraschungen bereithält und dass das, was bis vor kurzem gedacht wurde, ständig in Frage gestellt und oft umgestoßen werden muss.
Diese »Umkehrung« weist darauf hin, dass das Kennzeichen des Lebens seine Widersprüchlichkeit ist. Die gesamte Menschheit, die auf ihrer Wanderung durch diesen seltsamen Ort, den wir Welt nennen, weiter gereift ist, hat das im Thema der Kindheit verborgene Paradox verstanden: nämlich, dass diejenigen, die »unmündig« erscheinen, die wahren »Erwachsenen« sind, dass die Kinder nicht die »Kleinen«, sondern die wahren »Großen« sind, dass sie nicht die Schwächsten, sondern die Stärksten sind, nicht die Unwichtigsten, sondern die Wertvollsten, kurz gesagt, dass »die Letzten die Ersten sein werden«.
Und auch, was noch skandalöser klingt, die Tatsache, dass die Kinder am intelligentesten sind. So sah es zumindest Alexandre Dumas, der feststellte: »Ich kann nicht verstehen, warum Kinder so intelligent und Erwachsene so schwachsinnig sind. Das muss das Ergebnis der Erziehung sein.«
Ein Satz, der Dostojewski zugeschrieben wird, verdeutlicht diesen Punkt noch weiter: »Wenn ein Mensch große Probleme hat, sollte er sich an ein Kind wenden; sie sind es, die auf die eine oder andere Weise den Traum und die Freiheit besitzen.«
Der große Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, durch den die Widersprüchlichkeit des Kindseins erfasst wurde, war zweifellos das Aufkommen des Christentums, mit einem Gott, der Kind wird, der in der Kälte einer Grotte weint und von einer jungen Mutter umsorgt wird. Dieses Kind wird zum Erwachsenen und Meister und stellte der Welt der Erwachsenen gerade die Kinder als Modell vor Augen, um in die Fülle des Lebens, in das Himmelreich zu gelangen.
Vor Christi Zeiten war das anders, obwohl schon die schärfsten Denker die kostbare Kraft, die in der kleinen Schatulle der zerbrechlichen Existenzen von Kindern verborgen ist, begriffen hatten. Offenbar war es Perikles, der sich mit folgenden Worten an seine Frau Aspasia wandte und sie ermahnte, mit ihrem kleinen Kind »sorgsam umzugehen«: »Frau, denke daran, dass Griechenland über die Welt herrscht, Athen über Griechenland, ich über Athen, du, Frau, über mich, und dieses Kind über dich. Kümmere dich also gut um es, denn du siehst, wie viel Macht auf seinen kleinen Schultern ruht.«
Aber vielleicht ist die Vorstellung, das Lebensalter mit seiner zunehmenden Stärke und Weisheit sei das bestimmende Element, nur eine Konvention und womöglich ist die Wahrheit viel nuancierter und komplexer. Zumindest scheint Pablo Neruda das zu denken, wenn er schreibt: »Ich glaube nicht an das Alter / Alle alten Männer / tragen / in ihren Augen / ein Kind / und Kinder / beobachten uns manchmal / wie tiefsinnige Ältere.« Kinder beobachten uns, und wir und sie schauen uns gegenseitig an. Das Gebiet, auf dem sich diese Blicke treffen, ist das der Zuneigung und der Erziehung (die zusammenfallen sollten), und man fragt sich, ob im grellen Licht von Dumas’ scherzhafter Bemerkung die Erziehung eine von vornherein verlorene Schlacht ist.
Die Ironie des französischen Schriftstellers wird ergänzt durch die Feststellung des Engländers Chesterton: »Während sich die Gesellschaft in einer fruchtlosen Diskussion über die Unterdrückung der Frau abmüht, wird niemand sagen, wie viel wir der Tyrannei und dem Privileg der Frau verdanken, der Tatsache, dass sie allein die Erziehung regelt, bis sie sozusagen überflüssig wird, weil das Kind erst dann in die Schule geschickt wird, um erzogen zu werden, wenn es zu spät ist, es zu erziehen.«
Ist also alles verloren? Ist die Formung der jungen Generation immer eine De-formation? Vielleicht sollten wir zwischen Erziehung, Ausbildung und Formung unterscheiden. Und schon hier zeigt sich, wie umfangreich und komplex das Problem ist. In einer Zeitungskolumne, die zwangsläufig kurz ist, können solche Fragen nicht erschöpfend behandelt werden, aber es ist erlaubt, ja es ist sogar Pflicht, das Nachdenken unserer Leser weiter anzuregen und vielleicht zu versuchen, ein wenig Hoffnung zu vermitteln.
Es lohnt sich also, den erhellenden Brief noch einmal zu lesen, den Albert Camus nach der Verleihung des Nobelpreises an seinen Grundschullehrer Louis Germain schrieb: »Sehr geehrter Herr Germain, ich habe gewartet, bis der Trubel, der mich in diesen Tagen umgibt, abgeklungen ist, bevor ich mich ganz offen an Sie wende. Man hat mir eine viel zu große Ehre erwiesen, die ich weder gesucht noch erbeten habe. Aber als mich die Nachricht erreichte, galt mein erster Gedanke, nach meiner Mutter, Ihnen. Ohne Sie, ohne die liebevolle Hand, die Sie dem armen Kind, das ich war, gereicht haben, ohne Ihre Lehre und Ihr Beispiel, hätte es das alles nicht gegeben. Ich überbewerte diese Art von Ehre nicht. Aber es ist zumindest eine Gelegenheit, Ihnen zu sagen, was Sie für mich waren und immer noch sind, und Ihnen zu versichern, dass Ihre Bemühungen, Ihre Arbeit und die Großzügigkeit, die Sie in sie gesteckt haben, immer in einem Ihrer Schüler lebendig sind, der trotz seines Alters nicht aufgehört hat, Ihr dankbarer Schüler zu sein. Ich umarme Sie mit all meiner Kraft.«
Bildung als eine liebevolle Hand, die dem »armen Kind« entgegengestreckt wird. Fast kann man die kontinuierlichen Aufrufe von Papst Franziskus zu diesen Gesten der Fürsorge, der Stärkung und der Nähe hören. Und der Aufmerksamkeit. Das ist das Hauptbedürfnis, auf das in diesen Versen von Shel Silverstein angespielt wird: »Sagte das Kind: ›Manchmal lasse ich meinen Löffel fallen.‹ / Sagte der alte Mann: ›Das passiert mir auch.‹ / Das Kind flüsterte: ›Ich mache mir in die Hose.‹ / ›Das mache ich auch‹, sagte der alte Mann lachend. / Das Kind sagte: ›Ich weine viel.‹ / Der alte Mann nickte: ›Ich auch.‹ / ›Aber das Schlimmste ist‹, sagte das Kind, / ›dass die Erwachsenen mich nicht beachten.‹ / Und es spürte die Wärme einer faltigen alten Hand. / ›Ich weiß, was du meinst‹, sagte der alte Mann.«
Aber da das Widersprüchliche die »Regel« des Lebens ist, sollten wir versuchen, die Perspektive auf den Kopf zu stellen, und ein weiterer Dichter, einer der Großen des 20. Jahrhunderts, Rainer Maria Rilke, hilft uns dabei, wenn er in geheimnisvollen und beunruhigenden Worten die absolute Notwendigkeit einer »glückseligen Einsamkeit« für Erwachsene fordert: »Was not tut, ist doch nur dieses: Einsamkeit, große innere Einsamkeit. In-sich-Gehen und stundenlang niemandem begegnen – das muss man erreichen können. Einsam sein, wie man als Kind einsam war.« Vielleicht ist es diese Bedingung, auf die Jesus anspielte, als er die Gestalt des Kindes als Vorbild vorschlug? »Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf« (Mt 18,3-5). In der Tat, wenn man die vier kurzen Evangelien richtig liest, war auch er, Jesus, in vielen Momenten seines Lebens auf dieser Erde, und besonders in seinen letzten Stunden, allein, so wie ein Kind allein ist.
(Orig. ital. in O.R. 4.2.2025)




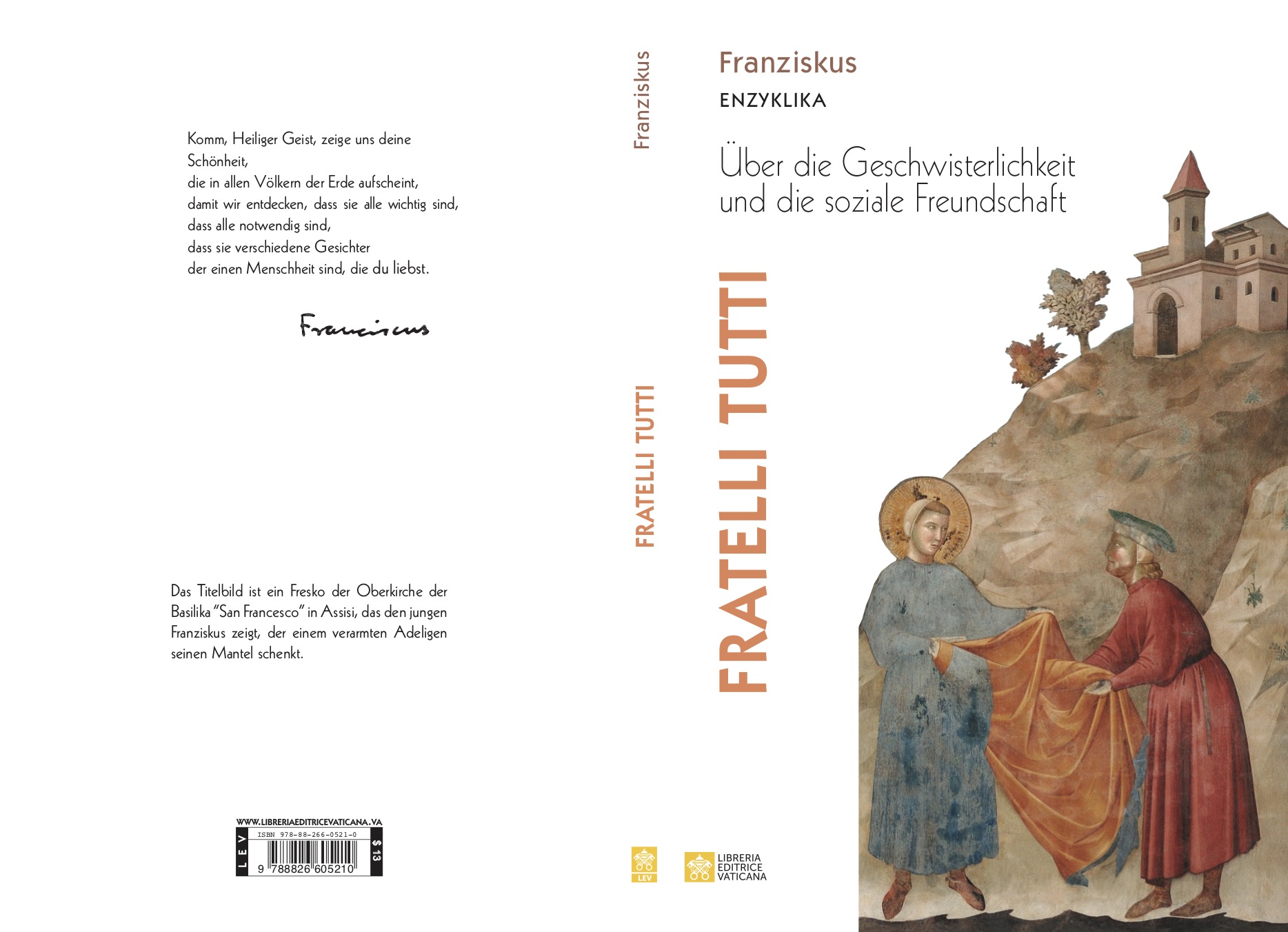 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti