
Mitten im Heiligen Jahr 2025, das Papst Franziskus ausgerufen hat und der Verlebendigung der christlichen Hoffnung gewidmet ist, wird auch der 1700. Jahrestag des Ersten Ökumenischen Konzils in der Kirchengeschichte gefeiert werden, das im Jahre 325 in Nizäa stattgefunden hat. Dieses Jubiläum weist wichtige ökumenische Perspektiven auf, die bereits daran abgelesen werden können, dass Papst Franziskus den Wunsch geäußert hat, nach Nizäa zu gehen und zusammen mit dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. diesen Gedenktag zu begehen. Auch die Kommission »Faith and Order« des Ökumenischen Rates der Kirchen bereitet sich auf diese Feier vor.
Gemeinchristliches Glaubensbekenntnis
Ökumenisch von Gewicht sind in erster Linie die doktrinellen Fragen, mit denen sich das Konzil beschäftigt und die es in der »Erklärung der 318 Väter« zusammengefasst hat. Mit ihr bekennen die Väter den »einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, geboren aus dem Vater als Einziggeborener, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, geboren, nicht geschaffen, wesensgleich mit dem Vater, durch den alles geworden ist im Himmel und auf der Erde«. Und im Brief der Synode an die Ägypter haben die Väter mitgeteilt, der allererste Untersuchungsgegenstand sei die »Glaubensfeindschaft und Gesetzwidrigkeit des Arius und seiner Anhänger« gewesen, und sie hätten deshalb einstimmig beschlossen, »seine glaubensfeindliche Lehrmeinung sowie seine blasphemischen Aussagen und Bezeichnungen, mit deren Hilfe er den Sohn Gottes schmähte, mit dem Anathem zu belegen«.
Mit diesen Aussagen ist der Hintergrund des vom Konzil formulierten Glaubensbekenntnisses zu Jesus Christus als dem Sohne Gottes, der »wesensgleich mit dem Vater« ist, skizziert. Der geschichtliche Hintergrund hat in einem heftigen Streit bestanden, der in der damaligen Christenheit vor allem im östlichen Teil des Römischen Reiches entbrannt war und dokumentiert, dass am Beginn des 4. Jahrhunderts die Christusfrage zum Problem des christlichen Monotheismus geworden ist. Der Streit hat sich vor allem um die Frage gedreht, wie das christliche Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohne Gottes mit dem ebenso christlichen Glauben an einen einzigen Gott im Sinne des monotheistischen Bekenntnisses vereinbart werden kann.
Vor allem der alexandrinische Theologe Arius hat einen strengen Monotheismus in der Sinnrichtung des damaligen philosophischen Denkens vertreten und, um einen derart strikten Monotheismus durchhalten zu können, Jesus Christus aus dem Gottesbegriff ausgeklammert. In dieser Sicht kann Christus nicht im eigentlichen Sinn »Sohn Gottes« sein, sondern nur ein Mittelwesen, dessen sich Gott bei der Erschaffung der Welt und bei seinen Beziehungen mit den Menschen bedient. Dieses von Arius propagierte Modell eines strengen philosophischen Monotheismus haben die Väter auf dem Konzil mit dem Glaubensbekenntnis zurückgewiesen, dass Jesus Christus als Sohn Gottes »wesensgleich mit dem Vater« ist.
Mit dem Wort »homoousios« haben die Konzilsväter das innerste Geheimnis Jesu Christi zum Ausdruck bringen wollen, von dem die Heilige Schrift bezeugt, dass er der treue Sohn des Vaters ist, mit dem er im Gebet zuinnerst verbunden ist. Denn es ist das Beten Jesu, in dem er am deutlichsten als der Sohn des himmlischen Vaters in Erscheinung tritt. Im Neuen Testament ist es vor allem der Evangelist Lukas, der Jesus in seinem irdischen Leben als durch und durch betenden Sohn Gottes zeichnet, dessen existenzielle Mitte die Zwiesprache mit seinem himmlischen Vater ist, mit dem er in innerster Einheit lebt. Jesus hat so sehr im Gebet und aus dem Gebet gelebt, dass man sagen muss, dass sein ganzes Leben und Wirken ein einziges Gebet gewesen ist. Ohne diese Lebenshaltung des Gebetes kann man die Gestalt Jesus Christus überhaupt nicht verstehen. Genau dies haben die Väter des Konzils von Nizäa sensibel wahrgenommen und mit dem Wort »homoousios« die adäquate Auslegung des Betens Jesu und die tiefste Interpretation des Lebens und Sterbens Jesu gegeben, das durchgehend vom Sohnesgespräch mit dem Vater bestimmt gewesen ist.
Mit dem Wort »homoousios« hat das Konzil von Nizäa keineswegs den biblischen Glauben »hellenisiert« und ihn einer fremden Philosophie unterworfen, sondern hat das unvergleichlich Neue festhalten wollen, das im Beten Jesu mit seinem Vater sichtbar geworden ist. Es ist vielmehr Arius gewesen, der den christlichen Glauben dem damals aufgeklärten philosophischen Denken angepasst hat, während demgegenüber das Konzil von Nizäa die damalige Philosophie aufgenommen hat, um das Unterscheidende des christlichen Glaubens auszudrücken. Im Bekenntnis von Nizäa hat deshalb das Konzil erneut wie und mit Petrus in Caesarea Philippi gesprochen: »Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes« (Mt 16,16).
Das Bekenntnis des Konzils zu Jesus Chris-tus ist zur Grundlage des gemeinsamen christlichen Glaubens geworden. Diese wichtige Bedeutung kommt dem Konzil bereits deshalb zu, weil es zu einer Zeit stattgefunden hat, in der die Christenheit noch nicht von den vielen späteren Spaltungen verwundet gewesen ist. Dieses Bekenntnis ist nicht nur den orientalischen und orthodoxen Kirchen und der katholischen Kirche, sondern auch den aus den Reformationen hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften gemeinsam; es kann deshalb in seiner ökumenischen Bedeutung nicht unterschätzt werden. Sie besteht vor allem darin, dass für die Wiedergewinnung der Einheit der Kirche die Übereinstimmung im wesentlichen Inhalt des Glaubens erforderlich ist, und zwar nicht nur zwischen den heutigen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, sondern auch die Übereinstimmung mit der Kirche der Vergangenheit und vor allem mit ihrem apostolischen Ursprung. Denn die Einheit der Kirche liegt begründet im apostolischen Glauben, der jedem neuen Glied am Leibe Christi in der Taufe übergeben und anvertraut wird.
Fundament geistlicher
Christus-Ökumene
Da die Einheit nur im gemeinsamen Glauben wiedergefunden werden kann, erweist sich das christologische Bekenntnis des Konzils von Nizäa als Fundament einer geistlichen Ökumene. Dabei handelt es sich freilich um einen Pleonasmus. Denn christliche Ökumene ist entweder geistlich oder nicht, weshalb das Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils den geistlichen Ökumenismus als »Seele der ganzen ökumenischen Bewegung« bezeichnet (Unitatis redintegratio, 8). Dies hat sich bereits am Beginn der Ökumenischen Bewegung gezeigt, an dem die Einführung der Gebetswoche für die Einheit der Christen gestanden hat, die ihrerseits eine ökumenische Initiative gewesen ist. Die Ökumenische Bewegung ist von Anfang an eine Gebetsbewegung gewesen. Es ist das Gebet um die Einheit der Christen gewesen, das den Weg der Ökumenischen Bewegung geöffnet hat.
In der Zentralität des Gebetes kommt an den Tag, dass das ökumenische Bemühen vor allem eine geistliche Aufgabe ist, die in der Überzeugung wahrgenommen wird, dass der Heilige Geist das ökumenische Werk begonnen hat und es auch vollenden und uns dabei den Weg zeigen wird. Dies gilt vor allem dann, wenn sich geistliche Ökumene als Christus-Ökumene versteht und vollzieht, wofür das Konzil von Nizäa ein solides Fundament bildet. Denn die Herzmitte christlicher Ökumene besteht in der gemeinsamen Umkehr aller Christen und Kirchen zu Jesus Christus, in dem die Einheit uns bereits vorgegeben ist. Christliche Ökumene kann in glaubwürdiger Weise nur vorankommen, wenn sie gemeinsam bei der Quelle des Glaubens einkehrt, die wir nur in Jesus Chris-tus finden können, wie ihn die Konzilsväter in Nizäa bekannt haben.
In dieser Weise entspricht christliche Ökumene am Tiefsten dem Willen des allen Chris-ten gemeinsamen Herrn, der in seinem Hohepriesterlichen Gebet um die Einheit seiner Jünger gebetet hat: »dass alle eins seien« (Joh 17, 21). Bei dem Gebet Jesu fällt in die Augen, dass er seinen Jüngern die Einheit nicht befiehlt und sie auch nicht von ihnen einfordert, sondern für sie betet, und zwar mit einem an seinen himmlischen Vater gerichteten Gebet. An diesem Gebet können wir am besten ablesen, worin auch die ökumenische Suche nach der Wiedergewinnung der Einheit im Licht des Glaubens besteht und bestehen muss. Christliche Ökumene kann nur Einstimmen aller Christen in das Hohepriesterliche Gebet des Herrn sein, indem sie sich sein Herzensanliegen der Einheit zu eigen machen. Wenn Ökumene nicht einfach zwischenmenschlich und rein philanthropisch, sondern wirklich christologisch motiviert und fundiert ist, kann sie nichts anderes sein als Teilhabe am Hohepriesterlichen Gebet Jesu. Die tiefste Bedeutung einer geistlichen Ökumene im Sinne der Christus-Ökumene besteht deshalb darin, dass wir alle uns in die Gebetsbewegung Jesu hin zu seinem himmlischen Vater hineinziehen lassen und in dieser Weise unter uns eins werden. Denn der innere Ort der Einheit der Christen kann nur das Gebet Jesu sein.
Bleibende Aktualität
des Konzils
Wenn wir diese vielfältigen Perspektiven im christologischen Bekenntnis des Konzils von Nizäa vor Augen halten, erweist es sich als ein wichtiges Gebot der ökumenischen Stunde, dass sein 1700-Jahr-Jubiläum von allen christlichen Kirchen in ökumenischer Gemeinschaft begangen und sein Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus neu angeeignet wird. Dieses Gebot drängt sich auch aus einem weiteren Grund auf. Wenn wir ehrlich in die heutige Glaubenswelt in unseren Breitengraden hineinblicken, müssen wir wahrnehmen, dass wir uns wiederum in einer ähnlichen Situation wie im 4. Jahrhundert vorfinden, insofern ein starkes Wiedererwachen von arianischen Tendenzen festzustellen ist.
Bereits in den 1990er-Jahren hat Kardinal Joseph Ratzinger die eigentliche Herausforderung der Christenheit in der heutigen Zeit in einem »neuen Arianismus« wahrgenommen. Der Geist des Arius zeigt sich vor allem darin an, dass sich auch heute nicht wenige Chris-ten zwar durchaus von allen menschlichen Dimensionen an der Gestalt Jesus von Nazaret berühren lassen, dass ihnen aber das Glaubensbekenntnis, dass Jesus von Nazaret der eingeborene Sohn des himmlischen Vaters ist, und damit der kirchliche Christusglaube weithin Mühe bereitet. Selbst in der Kirche und in der Ökumene scheint es heute oft nicht mehr zu gelingen, im Menschen Jesus das Antlitz Gottes selbst wahrzunehmen und ihn als Gottessohn zu bekennen und in ihm nicht einfach einen – wenn auch besonders guten und hervorragenden – Menschen zu sehen.
Wenn Jesus aber, wie heute selbst nicht wenige Christen annehmen, nur ein Mensch gewesen wäre, der vor zweitausend Jahren gelebt hat, dann wäre er unwiderruflich in die geschichtliche Vergangenheit zurückgetreten, und nur unser menschliches Erinnern könnte ihn mehr oder weniger deutlich in unsere Gegenwart zurückholen. So aber könnte Jesus nicht der einzige Sohn Gottes sein, in dem Gott selbst bei uns gegenwärtig ist. Nur wenn das kirchliche Bekenntnis wahr ist, dass Gott selbst Mensch geworden und Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und so Anteil hat an der Gegenwart Gottes, die alle Zeiten umgreift, können wir ihn auch heute als »wesensgleich mit dem Vater« bekennen.
Mit dem christologischen Bekenntnis des Konzils von Nizäa steht oder fällt der christliche Glaube auch heute. Die Beschäftigung mit diesem Konzil kann deshalb nicht nur von historischem Interesse sein. Sein Glaubensbekenntnis behält vielmehr auch und gerade in der heutigen Glaubenssituation seine wichtige Aktualität. Und die Verlebendigung seines Bekenntnisses zu Jesus Christus stellt eine Herausforderung dar, die in ökumenischer Gemeinschaft wahrgenommen werden muss.
Suche nach einem
gemeinsamen Osterdatum
Das Konzil von Nizäa ist in ökumenischer Sicht auch deshalb bedeutsam, weil es sich neben dem christologischen Bekenntnis auch mit disziplinären und kanonischen Fragen beschäftigt hat, die in zwanzig Canones dargeboten werden und einen guten Einblick in die pastoralen Probleme und Sorgen in der Kirche am Beginn des 4. Jahrhunderts bieten. Dabei geht es um Fragen, die den Klerus betreffen, ferner Jurisdiktionskonflikte, Fälle des Glaubensabfalls und die Situation der Novatianer, der so genannten »Reinen«, und der Anhänger des Paul von Samosata.
Die bedeutendste pastorale Frage ist dabei diejenige des Ostertermins gewesen, die es an den Tag bringt, dass bereits in der frühen Kirche das Datum des Osterfestes umstritten gewesen ist und deshalb verschiedene Datierungen vorhanden gewesen sind: Die Chris-ten vor allem in Kleinasien haben Ostern parallel zum jüdischen Paschafest immer am
14. Nisan gefeiert und sind deshalb Quartodezimaner genannt worden. Demgegenüber haben die Christen vor allem in Syrien und Mesopotamien, die als Protopaschisten bezeichnet worden sind, Ostern jeweils am Sonntag nach dem jüdischen Pascha gefeiert. Angesichts dieser Situation macht es das Verdienst des Konzils von Nizäa aus, dass es eine einheitliche Reglung gefunden hat, über die es in seinem »Brief an die Ägypter« mit den Worten berichtet hat: »Als gute Botschaft teilen wir euch auch die Übereinstimmung über das heilige Pascha mit: Dank eurer Gebete kam es auch in diesem Punkt zu einer glücklichen Lösung.« Diese hat darin bestanden, dass das Paschafest in Übereinstimmung mit den Römern gefeiert werden soll.
Im Blick auf das Osterdatum ist in der Geschichte der Christenheit vor allem im
16. Jahrhundert eine neue Situation entstanden, als Papst Gregor XIII. mit einer grundlegenden Kalenderreform den sogenannten Gregorianischen Kalender eingeführt hat, demgemäß Ostern immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Während seither die Kirchen im Westen das Datum von Ostern nach diesem Kalender berechnen, feiern die Kirchen im Osten weitgehend noch immer nach dem Julianischen Kalender, an dem sich auch das Konzil von Nizäa orientiert hat.
Wiewohl in der Zwischenzeit verschiedene Vorschläge für ein gemeinsames Osterdatum diskutiert worden sind, ist diese Frage auch heute noch nicht gelöst. Zu dieser pas-toral vordringlichen Herausforderung hat sich bereits das Zweite Vatikanische Konzil in einem Anhang zu der im Jahre 1963 promulgierten Konstitution über die Heilige Liturgie Sacrosanctum concilium geäußert und betont, dass es »dem Verlangen vieler, das Osterfest auf einen bestimmten Sonntag anzusetzen und den Kalender festzulegen«, »nicht geringe Bedeutung« beimisst. Das Konzil hat dabei seine Offenheit für die »Festlegung des Osterfestes auf einen bestimmten Sonntag im Gregorianischen Kalender« erklärt, und zwar unter der Voraussetzung, dass »alle, die es angeht, besonders die von der Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl getrennten Brüder, zustimmen«. Mit derselben Offenheit hat sich auch Papst Franziskus immer wieder geäußert.
Der 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa bietet eine besondere Gelegenheit, diese Frage wieder aufzugreifen, zumal im Jahre 2025 die Kirchen in Ost und West wieder einmal an demselben Tag, nämlich am 20. April, gemeinsam Ostern feiern können. Von daher versteht es sich, dass der Wunsch wieder wach geworden ist, das große Konzilsjubiläum zum Anlass zu nehmen, die Bemühungen um ein inskünftig gemeinsames Osterdatum in ökumenischer Gemeinschaft wieder aufzugreifen und zu intensivieren.
Synodaler Stil
In ökumenischer Hinsicht ist das Konzil von Nizäa auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil es die Art und Weise dokumentiert, wie der damals heftige Streit um das orthodoxe Christusbekenntnis und die pastoral-disziplinäre Frage des Osterdatums in einem synodalen Stil beraten und entschieden worden sind. Der Kirchenschriftsteller Eusebius von Caesarea, der selbst Konzilsvater gewesen ist und im Konzil von Nizäa gleichsam ein neues Pfingsten gesehen hat, hat eigens hervorgehoben, auf dem Konzil seien die ersten Diener Gottes »von allen Kirchen aus ganz Europa, Afrika und Asien« versammelt gewesen. Man darf deshalb das Konzil von Nizäa als gesamtkirchlichen Beginn der synodalen Art und Weise der Entscheidungsfindung und Entscheidung in der Kirche erblicken.
Der 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa ist von daher auch als Einladung und Herausforderung zu verstehen, aus der Geschichte zu lernen und den synodalen Gedanken zu vertiefen und im kirchlichen Leben zu verankern. Denn die heutige Verlebendigung der synodalen Dimension der Kirche erweist sich nicht als eine Neuheit; sie kann vielmehr an synodalen Traditionen in der frühen Kirche anknüpfen. Bereits der bedeutende Kirchenvater Johannes Chrysostomos hat erklärt, »Kirche« sei ein Name, »der für einen gemeinsamen Weg steht«, und Kirche und Synode seien deshalb »Synonyme«.
Diesbezüglich kann man auch in den ökumenischen Dialogen viel voneinander lernen, da die Synodalität in den verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in unterschiedlicher Weise entfaltet worden ist. Dies haben die Internationalen Ökumenischen Symposien über Konzepte und Erfahrungen der Synodalität in den christlichen Kirchen in Ost und West gezeigt, die vom »Institut für ökumenische Studien« an der Päpstlichen Universität des heiligen Thomas von Aquin unter dem Titel »Listening to the East« and »Listening to the West« zur Vorbereitung der Bischofssynode durchgeführt worden sind. Sie haben eindrücklich dokumentiert, dass die katholische Kirche bei der Verlebendigung eines synodalen Lebensstiles und entsprechender Strukturen von den theologischen Denkbemühungen und Erfahrungen in anderen Kirchen bereichert werden kann, und dass die Vertiefung der synodalen Dimension in Theologie und Praxis der katholischen Kirche auch einen wichtigen Beitrag darstellt, den sie in die ökumenischen Gespräche einbringen kann, und zwar nicht zuletzt im Blick auf ein adäquateres Verständnis der Interdependenz von Synodalität und Primat.
Die ökumenische Perspektive der Synodalität ist in besonderer Weise auch auf der Vollversammlung der Bischofssynode präsent gewesen. Papst Franziskus hat die Interdependenz zwischen der Synodalität und dem ökumenischen Weg immer wieder dahingehend ausgesprochen, dass der Weg der Synode, den die katholische Kirche unternommen hat, ökumenisch sein müsse, genauso wie der ökumenische Weg synodal sei. Darstellung und Diskussion der Synodalität in der katholischen Kirche erfolgt deshalb sinnvollerweise in einer ökumenischen Optik.
Kirchliche und
staatliche Autorität
Zwischen den heutigen Bemühungen um Verlebendigung der Synodalität und dem Konzil von Nizäa besteht allerdings ein grundlegender Unterschied, der nicht vernachlässigt werden darf. Auf den ersten Blick mag er als nebensächlich eingestuft werden, er ist aber zumal in ökumenischer Sicht als nicht unbedeutend einzuschätzen. Gemeint ist der geschichtliche Sachverhalt, dass das Konzil von Nizäa von einer staatlichen Autorität, genauer von Kaiser Konstantin einberufen worden ist. Er hat in dem damals entbrannten Streit um das Christusbekenntnis eine große Gefahr für seinen Plan wahrgenommen, die Einheit des Reiches auf dem Fundament der Einheit des christlichen Glaubens zu festigen. In der Situation einer drohenden Kirchenspaltung hat er in erster Linie ein politisches Problem gesehen: er ist aber weitsichtig genug gewesen, um einzusehen, dass die Einheit der Kirche nicht auf politischem, sondern auf kirchlich-theologischem Weg gelöst werden muss. Um die damals einander bekämpfenden Gruppierungen zu versöhnen, hat er das Erste Ökumenische Konzil in die kleinasiatische Stadt Nizäa in der Nähe der Kaiserresidenz Nikomedia einberufen.
Zu den unerfreulichen Konsequenzen dieses Vorgehens gehört auch die Tatsache, dass nach Konstantin die Kaiser – wie vor allem sein Sohn Konstantius – wieder eine entschiedene Politik der Abkehr vom Glaubensbekenntnis des Konzils von Nizäa betrieben und die Irrlehre des Arius wieder gefördert haben. Dies bedeutet, dass mit der Konzils-entscheidung von Nizäa der Streit über die Vereinbarkeit zwischen dem Bekenntnis zum Gottsein Jesu Christi und der monotheistischen Überzeugung im 4. Jahrhundert nicht beendet werden konnte, sondern der Streit, ob Jesus Christus auf die Seite Gottes oder auf die Seite der Schöpfung gehört, neu entbrannt ist. Dies ist in einem solchen Ausmaß der Fall gewesen, dass Basilius, der bedeutende Bischof von Caesarea, die Situation nach dem Konzil von Nizäa mit einer Seeschlacht in der Nacht, in der sich alle gegen alle schlagen, verglichen und geurteilt hat, in der Folge der konziliaren Dispute würden in der Kirche »eine entsetzliche Unordnung und Verwirrung« und ein »unaufhörliches Geschwätz« herrschen.
In ökumenischer Hinsicht wichtig ist die Feststellung, dass sich auf diesem geschichtlichen Hintergrund in der Kirche in Ost und West verschiedene Konzeptionen vom Verhältnis von Kirche und Staat herausgebildet haben. Die Kirche im Westen hat in einer langen und verwickelten Geschichte lernen müssen – und auch gelernt –, dass in der Trennung von Kirche und Staat bei gleichzeitiger Partnerschaft zwischen beiden Realitäten die adäquate Ausgestaltung ihres Verhältnisses besteht. In der Kirche des Ostens ist demgegenüber eine enge Verbindung zwischen der staatlichen Herrschaft und der kirchlichen Hierarchie dominierend geworden, die als »Symphonie von Staat und Kirche« gekennzeichnet zu werden pflegt und vor allem in den orthodoxen Konzeptionen der Autokephalie und des sogenannten Kanonischen Territoriums zum Ausdruck kommt.
Die unterschiedlichen Traditionen in der Ausgestaltung des Verhältnisses von Kirche und Staat haben in der Geschichte oft im Hintergrund von Auseinandersetzungen in der Kirche zwischen Ost und West gestanden und haben nicht leichte Auswirkungen auch auf die ökumenischen Beziehungen gehabt. Sie gehören jedoch bisher zu den in den ökumenischen Dialogen am wenigsten behandelten Themen. Sie bedürfen aber in der Zukunft auf der ökumenischen Traktandenliste einer besonderen Aufmerksamkeit, zumal angesichts des großen Jubiläums des Konzils von Nizäa im Jahre 2025.
Auf diesem Wege stellen die 1700 Jahre Konzil von Nizäa nicht nur eine willkommene Chance dar, das Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus, dem mit dem Vater wesensgleichen Sohn in ökumenischer Gemeinschaft zu erneuern, sondern auch eine wichtige Herausforderung, die in den bisherigen ökumenischen Gesprächen zu wenig behandelten Überhangprobleme aus der Vergangenheit entschieden aufzunehmen und zu besprechen. Wenn Chance und Herausforderung gleichermaßen wahrgenommen werden, kann der 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa zu einer ökumenischen Sternstunde werden.
Von Kardinal Kurt Koch




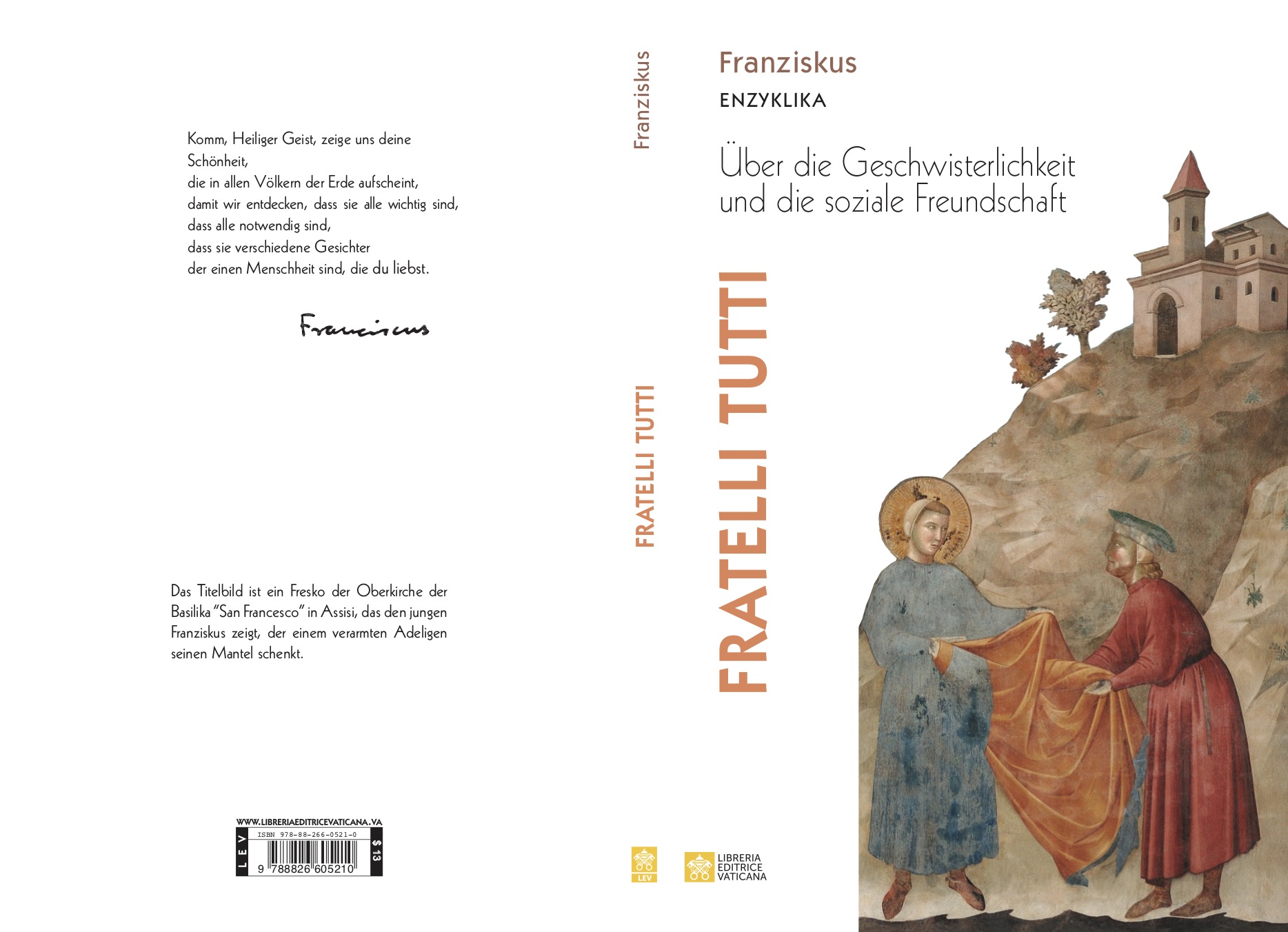 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti