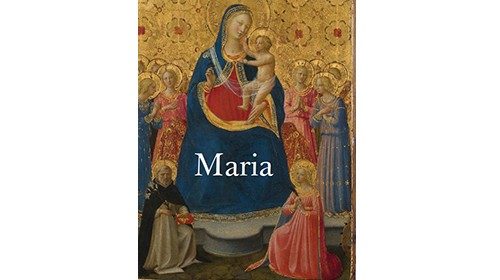
Als ich ein kleines Mädchen war, das in einem vorwiegend portugiesisch-römisch-katholischen Stadtviertel im Nordosten der Vereinigten Staaten aufwuchs, war ich fasziniert von Maria. Alle Statuen – und fast jede Familie hatte eine, sei sie nun klein auf dem Kaminsims oder größer auf dem Rasen im Vorgarten – zeigten sie mit wunderschönen Gesichtszügen, eleganten blauen Gewändern und der absolut schönsten Krone, die je getragen wurde.
Mein Lieblingsfilm war Die Heilige von Fatima aus dem Jahr 1952. Ich konnte mich nie entscheiden, ob ich lieber eine Erscheinung der Allerseligsten Jungfrau Maria gehabt hätte wie Lucia, Jacinta und Francisco, oder ob ich nicht lieber mit dem schönen Gilbert Roland, der Hugo da Silva, den männlichen Hauptdarsteller, verkörperte, durchgebrannt wäre.
Außerdem identifizierte ich mich als Kind mit Maria. Meine Mutter hatte mir gesagt, dass Maria genau wie ich Jüdin gewesen sei. Maria ging in die Synagoge, genau wie ich. Maria sprach die alten Gebete wie »Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig«, genau wie ich. Oft spielte ich, dass ich Maria sei: ich hüllte mich in ein blaues Leintuch, setzte als Kopfbedeckung einen blauen Kissenbezug auf, bastelte mir eine Krone aus Aluminiumblättern und lächelte alle, denen ich begegnete, süß an.
Andererseits hatte ich auch die Weihnachtsgeschichte gehört, wie der Engel Gabriel der Maria, einer jüdischen Jungfrau, erschienen war und ihr gesagt hatte, dass sie einen Sohn gebären würde. Ich war das einzige jüdische Mädchen, also die einzige jüdische Jungfrau, meines Viertels, deshalb stellte ich mir vor, dass Gabriel vielleicht auch mir erscheinen würde. Diese Vorstellung faszinierte mich einerseits, andererseits erschreckte sie mich aber auch.
Heute, als verheiratete Mutter zweier Kinder, will ich keine jungfräuliche Mutter mehr sein. Aber in meiner Eigenschaft als Dozentin für das Neue Testament fasziniert und inspiriert mich Maria nach wie vor. Ich frage mich, ob ihre Eltern sie wohl zu Ehren der Mirjam - der Schwester des Mose, der die Israeliten beim Exodus und in der Wüste geführt hatte – Maria genannt hatten. Oder ob sie sie nach Mariamne benannt haben, der Hasmonäer-Prinzessin, die mit Herodes dem Großen verheiratet war, dem jüdischen Symbol der Unabhängigkeit der römischen Herrschaft gegenüber? Was dachte Maria über die Politik, über den Tetrarchen Archelaos, der über Galiläa regierte, oder über die römischen Statthalter, die im Jahr 6 nach unserer Zeitrechnung die hebräische Herrschaft ablösten? Genauso wie meine Mutter mir Geschichten erzählt hat und ich sie meinen Kindern erzählt habe, denke ich, dass wohl auch Maria sie Jesus erzählt hat. Dem Buch Tobit zufolge hat die Großmutter des Tobias ihn die Torah gelehrt, genau wie die anderen jüdischen Frauen ihre Kinder unterrichteten. Maria hat Jesus zweifellos die Anweisungen der Torah darüber gelehrt, dass Gott und der Nächste zu lieben seien, Vorschriften, die ins »große Gebot« in Matthäus 22,36-40 und Marcus 12, 28-34 eingegangen sind. Vielleicht erzählte sie ihm, wie Mose sein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt hatte, wie König David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte, wie Judas Makkabäus die syrischen Streitkräfte besiegt hatte, die den Tempel in Jerusalem entweiht hatten. Wahrscheinlich erzählte sie ihm, wie die Propheten Elija und Elischa Tote ins Leben zurückgeholt und Hungernde mit Nahrung versorgt hatten; vielleicht erzählte sie ihm von Kain und Abel, Ismael und Isaak, Jakob und Esau, deren Geschichten der Geschichte des Verlorenen Sohnes zugrunde liegen. Vielleicht erzählte sie ihm aber auch vom Gottesknecht bei Jesaja, der stellvertretend für sein Volk leidet. Marias Einfluss auf ihren Sohn darf, auch wenn man ihn sich nur vorstellen kann, nicht unterschätzt werden.
Von Amy-Jill Levine













 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
