
Während der Heiligen Jahre übte Rom eine magnetische Anziehungskraft auf die Gläubigen aus, Pilger kamen in großer Zahl. Schon für wohlhabende Rompilger war es schwierig, eine Unterkunft zu finden, und wer nichts hatte, fand kaum Schutz vor Kälte oder Hitze.
Von Maria Milvia Morciano
Die zeitgenössischen Chroniken berichten aus Anlass der Heiligen Jahre, dass »riesige Scharen« von Pilgern nach Rom gekommen seien, und zwar »aus aller Welt«. Nur die Reicheren fanden Unterkunft in den Gasthäusern, Hotels oder zu mietenden Zimmern, für die Armen aber, und das war die große Mehrheit, war dies nicht möglich. Nicht nur Rom in den Heiligen Jahren, sondern auch Europa und das Heilige Land waren bereits in früheren Zeiten von einem dichten Netz von Hilfseinrichtungen überzogen. An den Pilgerwegen befanden sich »xenodochia«– oder Hospize – und »hospitalia«, Einrichtungen in oder bei Klöstern, die Arme und Pilger kos-tenlos aufnahmen und sie auch medizinisch versorgten.
In Rom war die Aufnahme der Pilger durch wohltätige Institutionen organisiert, von denen es in den drei Jahrhunderten nach dem ersten Heiligen Jahr bereits über 100 gab. Fremde konnten sich auch an die nationalen Stiftungen wenden, die mit den Ländern jenseits der Alpen in Verbindung standen, oder an die »Nationen« der verschiedenen Gebiete der italienischen Halbinsel, während kranke Pilger die Dienste der großen öffentlichen Krankenhäuser Roms in Anspruch nehmen konnten.
Das »gastfreundliche
und fürsorgliche« Rom
Camillo Fanucci schrieb in seiner Einleitung zum Trattato di tutte l’opere pie dell’alma città di Roma [Traktat über alle frommen Werke der Stadt Rom]: »Wenn ich im Heiligen Jahr 1575 über die großen Wohltaten erstaunt
war, die in Rom allen möglichen Leuten erwiesen wurden, die nach Rom kamen, um das heiligste Jubiläum zu begehen, so war ich in diesem Heiligen Jahr 1600 erstaunt, verblüfft und fast außer mir, als ich die großen und unermesslichen Werke der Nächstenliebe und Frömmigkeit sah, die von den Bruderschaften der genannten Stadt getan wurden …«
Im Jahr 1679 bestätigte Abt Carlo Bartolomeo Piazza diesen Eindruck in seiner Abhandlung Opere pie di Roma: Wie Rom in der Antike die von Christus gesandten Pilger Petrus und Paulus aufgenommen habe, so habe sie »vor allen Städten der Welt den Ruhm, die gastfreundlichste von allen gewesen zu sein und noch immer zu sein«. Der Abt zählt, wenn auch nur kurz, alle Einrichtungen auf, die nicht nur ausländischen Pilgern, sondern auch armen Römern helfen sollten. Rom genieße die Wohltätigkeit des Papstes, des »universalen Vaters der Armen aller Völker der Welt und Spender seines gesamten Vermögens«, durch »Almosen, die er privat verteilt, und Almosen, die durch die Hände seines Groß-Elemosinars gehen«. Wie Piazza berichtet, konnten es bis zu 10.000 Scudi pro Monat sein, die an die verschiedenen »schamhaften« Armen verteilt wurden – an durch Notlagen gedemütigte Menschen, die sich schämten, um Brot zu betteln – sowie an Krankenhäuser, Männer- und Frauenklöster und die verschiedenen »frommen Orte« in Rom.
Vorbeugende Maßnahmen
Die päpstlichen Behörden ergriffen vor jedem Jubiläum Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Stadt den großen Zustrom von Besuchern bewältigen konnte. Rechtzeitig wurden große Vorräte an Lebensmitteln und Holz importiert, aber es war nicht immer
möglich, den Bedarf zu decken, auch weil private Interessen zuweilen die Preise für Waren und Dienstleistungen in die Höhe trieben, was man durch Erlasse und Bekanntmachungen zu verhindern suchte. Quellen berichten von der Habgier der Gastwirte und Vermieter. So erzählt Matteo Villani, dass während des zweiten Jubiläums im Jahr 1350 » alle Römer zu Wirten gemacht wurden […], und um auf ungeordnete Weise Geld zu verdienen, hielten sie das ganze Jahr über Brot, Wein und Fleisch künstlich knapp, um ihre eigenen Waren teurer verkaufen zu können«. Die Zahl der Menschen, die nach Rom strömten, war so groß, dass oft nicht einmal diejenigen, die bereit waren, dafür zu bezahlen, eine Unterkunft finden konnten, und gezwungen waren, im Freien zu schlafen.
Heilige Jahre und Mieterschutz: Päpstliche Intervention
Die päpstlichen Behörden mussten nicht nur die Aufnahme der Pilger organisieren, sondern auch die römischen Bürger schützen, die Gefahr liefen, Opfer des unkontrollierten Anstiegs der Mieten während des Heiligen Jahres zu werden. Ein von Papst Paul III. im Jahr 1549 erlassenes Dekret verbot Mieterhöhungen und Zwangsräumungen während des Heiligen Jahres 1550. Leo XII. tat dasselbe für das Jubiläumsjahr 1825, wie es im Dekret von Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, Kardinaldiakon von Sant’Eustachio und Kämmerer der Heiligen Römischen Kirche, heißt: »Im Auftrag unseres heiligsten Herrn Papst Paul III. … legen wir fest und ordnen an, dass in Zukunft im Hinblick auf das Heilige Jahr oder das Jubiläum, immer wenn ein solches Jahr eintritt, für ein Jahr vor und für das besagte Heilige Jahr oder Jubiläum selbst die Miete der Häuser von den Eigentümern derselben für die Mieter nicht erhöht werden darf, noch darf die Art der Zahlung der Miete geändert werden. Außerdem ... um Streitigkeiten und Kontroversen zu vermeiden ... ordnen wir an, dass sowohl der Mieter selbst als auch der Untermieter desselben nicht aus dem gemieteten oder untervermieteten Haus durch den Vermieter desselben vertrieben werden darf.« Um sein Haus zurückzubekommen, musste der Besitzer »schwören, es nicht an andere zu vermieten, sondern es ein Jahr lang selbst zu bewohnen, unter Androhung der Strafe, dass er im Falle eines Meineids die Miete des betreffenden Hauses für zwei Jahre verliert«.
Hungrige speisen
Die Aufnahme der Pilger sollte gratis erfolgen und so hatten die Mönche die Gäste des Klosters zu verköstigen, was zum Teil auch dazu führte, dass die ihnen selbst zugeteilten Portionen kleiner wurden, vor allem wenn sie hochrangige Pilger samt Gefolge zu beherbergen hatten. Allerdings beglichen diese häufig ihre Schuld, indem sie Privilegien, Vermögenswerte oder Nutzungsrechte übertrugen oder Spenden hinterließen. In Bezug auf die Heiligen Jahre des 16. Jahrhunderts ist im Archiv der »Erzbruderschaft von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit der Pilger« (»Santissima Trinità dei Pellegrini«) ausführliches Dokumentationsmaterial erhalten, einschließlich der Speisenfolge für das Abendessen, die einzige Mahlzeit des Tages, weil die Pilger in der übrigen Zeit in den Kirchen unterwegs waren und nichts zu sich nahmen. Für die Verköstigung von 356 Personen sah die Speiseliste Salat, Brot, Fleisch und große Krüge mit Wein vor, und für den, der »kein Fleisch essen und Wasser trinken wollte« gab es auch ein Fischgericht oder etwas anderes »Mageres«. Man erzählt, dass während des Jubiläumsjahres 1675 die Fische, die Monsignore Giuseppe D’Aquino, Generalauditor der Apostolischen Kammer, den Pilgern servierte, so gut, vielfältig und zahlreich waren, dass sie »nicht nur die Tische, sondern auch die Taschen der Pilger füllten«.
Ein funktionierendes
Gesundheitswesen
Zwischen dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit wurde die Präsenz ausländischer Gemeinschaften in Rom stabiler und war besser organisiert. So entstanden auch »Einflusszonen« im Stadtgefüge, oft um die Sitze von Botschaften, insbesondere für Länder mit größerem politischem Gewicht wie Spanien und Frankreich. Seit dem späten Mittelalter hatten die verschiedenen ausländischen Gemeinschaften nationale Hospize und Bruderschaften gegründet, die in den Heiligen Jahren sehr aktiv waren, um ihre pilgernden Landsleute aufzunehmen. Zu den wichtigsten Gründungen gehörten das »Hospiz St. Jakobus und St. Ildefonso«, das spanische Pilger in Rom aufnahm, und »St. Ludwig der Franzosen« für Pilger von jenseits der Alpen. Neben den »Nationen« gab es auch zahlreiche Stiftungen der historischen Staaten der italienischen Halbinsel, wie »St. Johannes der Florentiner«.
In den Jahren nach dem ersten Jubiläum zählte man 25 Hospize, die sich mit der Zeit vervielfachten, bis hin zu den bedeutsamen Gründungen des 16. Jahrhunderts. Zu den wichtigsten Krankenhäusern gehörten das »Heilig-Geist-Spital in Sassia«, die Krankenhäuser »Allerheiligster Erlöser bei St. Johannes im Lateran«, »St. Jakobus der Unheilbaren« und »Maria vom Trost« am Forum Romanum. Erwähnenswert sind auch das St. Antonius-Krankenhaus, wo der heilige Franziskus gewohnt haben soll, sowie die Stiftung des »Pietà«-Krankenhauses, das sich später auf die Pflege von Geisteskranken spezialisierte und den Namen »Pietà dei Pazzerelli« – der verrückten Leute – erhielt; schließlich das Krankenhaus »Allerheiligste Dreifaltigkeit von den Pilgern«, das eng mit den Heiligen Jahren und dem heiligen Philipp Neri verbunden war.
Während in den vorangegangenen Jahrhunderten nicht zwischen der Gastfreundschaft für Pilger und der Hilfe für Kranke unterschieden wurde, kam es im Laufe der Zeit zu einer fortschreitenden Spezialisierung bis hin zur Behandlung bestimmter Krankheiten. Im Rom des 17. Jahrhunderts gab es etwa 20 öffentliche Krankenhäuser und 27 Hospize, die jeweils mit verschiedenen Nationalitäten und Bruderschaften verbunden waren. Zu den ältesten gehören die Gonfalone-Bruderschaft und die Bruderschaft des »Allerheiligsten Erlösers« (Santissimo Salvatore), die mit der Verehrung der Christusikone in der Kapelle »Sancta Sanctorum« im Lateran in Zusammenhang stand. Weiter die Bruderschaft vom Allerheiligsten Kreuz (Santissimo Crocifisso), verbunden mit dem wundertätigen Kreuz in der Kirche San Marcello al Corso, die »Erzbruderschaft des Gebets und des Todes«, die sich um die Bestattung armer, in Rom verstorbener Pilger kümmerte, und schließlich das Hospiz von San Michele a Ripa, eines der bedeutendsten karitativen Werke der Ewigen Stadt, initiierte von Papst Innozenz XII. im Vorfeld des Jubiläumsjahres 1700.
Das älteste
Krankenhaus Europas
An der Stelle der alten »Schola Saxorum« am Tiberufer wurde 1201 von Innozenz III. das Krankenhaus »Santo Spirito in Sassia ad usum infirmorum et pauperorum« neu gegründet. Es wurde auch von Martin Luther für seine Effizienz gelobt und verfügte über etwa 300 Betten. Jahrhundertelang wurden hier Pilger, Kranke und ausgesetzte Kinder aufgenommen. Die Regel des Hospitals besagte, dass an einem Tag in der Woche die armen Kranken auf den Straßen und Plätzen aufgesucht und in das Haus Santo Spirito gebracht werden sollten, um dort mit »größter Fürsorge« gepflegt zu werden, und die Regel besagte auch, dass die einfachen Armen, die im Haus Santo Spirito untergebracht werden wollten, »bereitwillig aufgenommen und wohltätig behandelt werden sollten«. Das Krankenhaus wurde von Sixtus IV. zwischen 1473 und 1480 – das heißt wenige Jahre nach dem berühmten Borgo-Brand, der 1514 von Raffael und seiner Werkstatt in den Vatikanischen Stanzen gemalt wurde – renoviert und der Aufnahme von Findelkindern gewidmet. Ein Jahrhundert später verwandelte Sixtus V. das Gebäude in ein Erzhospital. Es verfügte auch über einen Friedhof, auf dem die im Krankenhaus verstorbenen Pilger begraben wurden, und Ende des 18. Jahrhunderts kam das Krankenhaus San Carlo hinzu.
Philipp Neri
und die Pilger
Die Bruderschaft der Allerheiligsten Dreifaltigkeit der Pilger und Genesenden wurde 1548 unter dem Namen »Heilige Dreifaltigkeit von der Hilfe« gegründet. Sie hatte eine enge Verbindung zum Werk des heiligen Philipp Neri und diente dem Zweck, armen oder kranken Pilgern Gastfreundschaft und Hilfe zu gewähren. Sie wurde von Papst Paul III. anerkannt und bereits 1554 wurden die Statuten veröffentlicht. Im Jahr 1550 beherbergte die Bruderschaft in ihrem Haus die Pilger, die aus Anlass des Heiligen Jahres nach Rom gekommen waren, so konnte man ein wenig den großen Mangel an Unterkünften ausgleichen. Im 16. Jahrhundert begann eine Umstrukturierung in der Arbeit der Bruderschaft: Aufnahme und Bewirtung wurden in den Statuten detailliert geregelt, an die Regeln hatten sich sowohl die Pilger als auch die Mitglieder der Bruderschaft zu halten. Später wurde die Tätigkeit der Bruderschaft auf die Betreuung von Patienten ausgedehnt, die aus den Krankenhäusern entlassen wurden, aber Hilfe brauchten. Es entstand das erste »Genesungsheim« Europas. Paul IV. unterstützte die Initiative und übertrug der Bruderschaft 1558 die Kirche »San Benedetto alla Regola«, die kurz darauf in Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit umbenannt wurde. Pius IV. bestätigte die Einrichtung, genehmigte Statuten und Regeln der Bruderschaft und verlieh ihr 1562 den Titel einer Erzbruderschaft. Im Heiligen Jahr 1575 zeichnete sich die Einrichtung durch ihre hohe Effizienz und Spezialisierung aus und verdiente sich bei dieser Gelegenheit päpstliche Anerkennung, die 1576 in die Gewährung neuer Privilegien mündete.
Ein »Jubiläumsheiliger«
Wenn es eine Gestalt gibt, in der alle spirituellen Bedeutungen des Jubiläums zusammenlaufen und sich auch in konkreten Ges-ten niederschlagen, dann ist es der heilige Philipp Neri. Seine Wiederbelebung der alten Frömmigkeitsübung der »Sieben-Kirchen-Wallfahrt« wurde zu einem festen Bestandteil des Pilgerprogramms. Wir haben bereits die Gründung der Bruderschaft der »Dreifaltigkeit der Pilger« erwähnt, aber der Heilige war – wie Camillo de Lellis, Gaetano da Thiene und Felice da Cantalice – auch Mitglied des Hospitals von »St. Jakobus der Unheilbaren«, und er pflegte die Kranken in den Krankenhäusern Santo Spirito und San Giovanni. Er war ein Pilger unter Pilgern: Viele Orte in Rom zeugen von seinem Weg und seiner intensiven Hilfstätigkeit für die Ärmsten, die Kranken und die Ausgestoßenen. In der Kirche der Allerheiligsten Dreifaltigkeit der Pilger ist der Heilige mit einer weißen Schürze dargestellt, was auf einen grundlegenden Moment des Empfangs der Pilger anspielt: Den Pilgern wurden die Füße gewaschen, denn diese waren am Abend von dem langen Bußgang, der auch barfuß erfolgte, wund und schmutzig. Ein Ritual, das die Geste Christi am Gründonnerstag wiederholte und so seinem Beispiel konkret folgte. Philipps Schürze ist ein Zeichen für den Geist des Dienens, der sein Leben bestimmte.
(Orig. ital. in O.R. 6.12.2024)




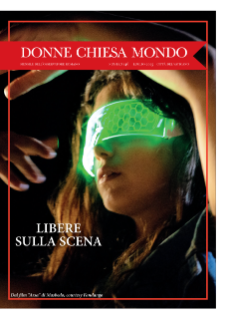
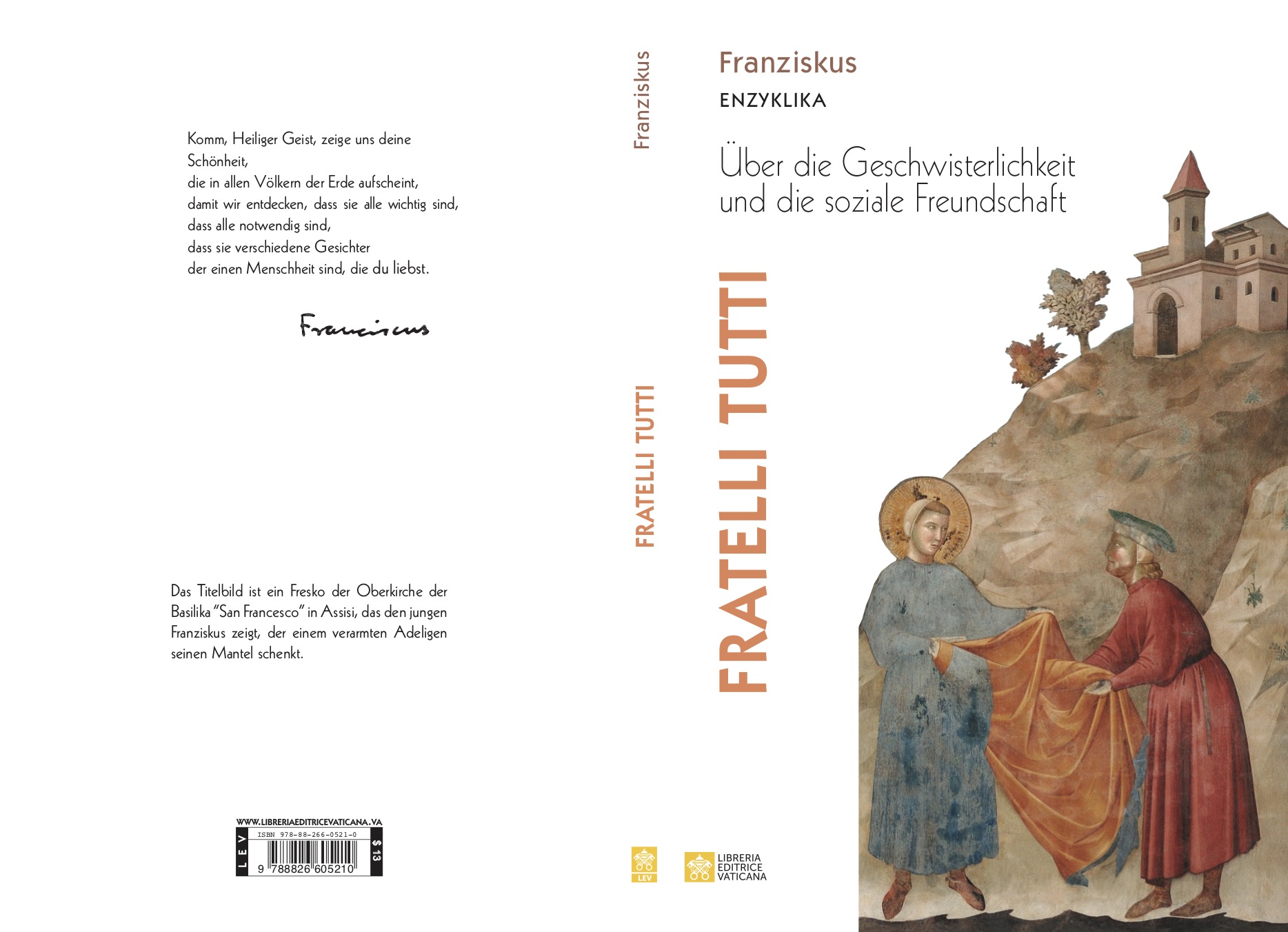 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti